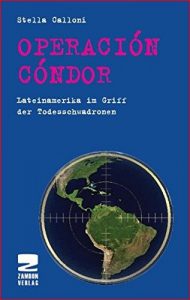Jorge Ricardo Masettis Begegnung mit Fidel Castro & Che, wie er sie erlebte.
Ende der 1950er Jahre reiste ein argentinischer Journalist zur kubanischen Guerilla, um über ihren Kampf gegen Batista zu berichten. Er wurde einer der ihren
Von Jorge Ricardo Masetti
Jorge Ricardo Masetti: Fidel Castro, wie ich ihn erlebte. Von Kämpfenden und Weinenden. Vorwort von Volker Hermsdorf. Aus dem Spanischen von Natalia Carvajal Saavedra. Zambon-Verlag, Frankfurt am Main 2018, 239 Seiten, 18 Euro
Auf dieses Buch habe ich schon seit einigen Jahren gewartet, spätestens seit ich Fidels Freundin Stella Calloni bei ihrer Lesung in Frankfurt am Main im Club Voltaire kennen lernte
und etwas korrigierend die Übersetzung durch eine in Deutschland und der Schweiz lebende brasilianische Übersetzerin begleiten durfte. Diese Übersetzerin entpuppte sich nach einigen Wochen Recherche zum Einen als äußerst charmantes und auch linke Männerherzen im Sturm eroberndes Modell aus dem Hause eines brasilianischen Logistik-Unternehmens, zum Anderen als eine auf die Umgebung Fidels angesetzte multilinguale V-Frau mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen.
Seit ich ihr auf die Spur gekommen bin, war sie urplötzlich von der Bildfläche verschwunden, sprich- und wort-wörtlich: jede Google-Suche nach ihr war ab dann ohne Ergebnis. Auch die Suche nach ihrem, von dahinschmelzenden Genossinnen umgebenen, bildschönen, sonorgestimmten Begleit-Gitarristen war in der Folge ebenso vergeblich.
Bilder von ihr & ihm dürfte der ZAMBON-Verlag noch im Archiv haben. Denn es wurde bei der Lesung ausführlich fotografiert.
Auszüge aus der Anfang April im Frankfurter Zambon-Verlag erstmals auf Deutsch erscheinenden Reportage »Fidel Castro, wie ich ihn erlebte« des argentinischen Journalisten Jorge Ricardo Masetti.
Ich danke meinem Verleger Dr. Giuseppe Zambon für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck.
»Die einzige Art und Weise, Amerika von Diktatoren zu befreien, ist, sie niederzuschlagen.« Che Guevara in der Sierra Maestra 1958
…… Als ich aus dem Flugzeug stieg, konnte ich nicht verhindern, mich aufgrund der klebrigen und flimmernden Hitze beklommen zu fühlen. Überdies überkam mich auch die Nervosität eines Debüts in Gefahr. Seitdem die Stewardess ihre Ansage, »Flughafen Rancho Boyeros, Havanna«, gemacht hatte, dachte ich angstvoll daran, wie verdächtige Reisende ausgesiebt wurden. Ich zerbrach mir den Kopf darüber, wie die Polizei agieren und was aus meinen erbärmlichen Ausreden, die einem fast gepäcklosen Touristen einfielen, werden würde.
Als ich mir im kubanischen Konsulat in Buenos Aires ein Visum besorgt und dem Konsul selbst in einem persönlichen Gespräch versichert hatte, dass mein Lebenstraum darin bestand, Cha Cha Cha unter Palmen zu tanzen, erklärte er mir, dass alles klargehen würde. Er sagte: »Sie wissen doch … Man glaubt immer, dass die jungen Leute Revolutionäre werden wollen.«
Ankunft in Havanna
Seine Worte machten mir verständlich, dass es förmlich ein Vergehen war, in Kuba jung zu sein. Und während sie mein spärliches Gepäck und meine Dokumente kontrollierten, bemerkte ich, dass ich dafür bezahlte. Von den elf Passagieren, die in Havanna ausgestiegen waren, war ich der einzige, dessen Kleidung durchsucht wurde. Bemüht, sorglos dreinzublicken, ließ ich mich von vier Männern durchsuchen, die aussahen, als hegten sie einen alten Groll gegen mich. Nicht weniger als zehn Figuren mit Hütchen, weißem Guayabera – dem typischen Leinenhemd – und identischer Grimasse uniformiert, lehnten an den Wänden und vermittelten mir mit ihren anmaßenden Blicken, dass sie ultrageheimste Geheimpolizisten waren und demzufolge … Man kann es sich denken.
Als man mir den Pass und die Dokumente überreichte, die bestätigten, dass ich kein Seuchenimporteur war, ließ ich mich genüsslich bis zum Ausgang führen, wo mich ein Mannsbild mit blauer Mütze in ein Auto steckte, in dem schon andere Personen saßen. Bei Vollgas entfernten wir uns von Rancho Boyeros und fuhren nun Richtung Havanna entlang einer wundervollen Allee, flankiert von Plakaten, auf denen stand: »Das Werk von Präsident Batista«. Der Wagen parkte vor dem Vestibül des berühmten Hotel Nacional. Dort ließ man alle mit ihrem Gepäck, also auch mich mit meinem Handkoffer, aussteigen. Doch ich stieg wieder in den Wagen. Der Fahrer machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, keinen distinguierten Gast zu fahren. Nun war ich nicht mehr der »Señor«, sondern bloß »Chico«, Bursche. Er setzte mich im Hotel ab, das mir von einem Freund in Buenos Aires empfohlen worden war. Natürlich war es viel billiger als das Nacional.
Dort standen an den Vestibülseiten wiederum ultrageheime Geheimdienstler mit weißen Guayaberas, gleichen Hütchen und identischen Grimassen. Kaum hatte ich meinen Handkoffer auf das Bett gelegt, begab ich mich auf die Suche nach jenem Mann, der einen Kontakt zu den Leuten des 26. Juli, der von Fidel Castro angeführten Bewegung aufbauen konnte. Ich fand ihn, und er enttäuschte mich.
»Die Sache ist zu wild, Chico. Das ist ein heißes Eisen. Man bereitet einen Generalstreik vor, und die Repression ist furchtbar. Du wirst dich damit zufriedengeben müssen, die Chronik darüber zu schreiben, was hier geschieht. Natürlich überzeugten mich seine Argumente nicht, und ich beharrte auf meinem Vorhaben. Er sagte mir daraufhin, dass der einzige schnelle Weg zur Kontaktherstellung über Santiago de Cuba führe, die östliche Hauptstadt und traditionell revolutionäre Provinz. Er kannte dort einen Mann, der mir eventuell ein Interview mit den lokalen Führern der Bewegung beschaffen könne. Ich prägte mir Namen und Adresse ein und ging. Zum Hotel kehrte ich zu Fuß zurück. Ich durchstreifte die leeren Straßen Havannas, die von leeren Kabaretts umsäumt waren, weil die Polizei es verlangte. Auf der Fahrbahn erschienen moderne blaue, weiße oder olivgrüne Automobile, rollende Festungen voller Männer mit Helmen, die die wenigen Fußgänger beobachteten. Die Bar- und Kabarettlautsprecher schrien wie verrückt das letzte Lied: »A la Rigola yo no vuelvo más, matan a los hombres por la madrugá …« (Zur Rigola kehre ich nicht zurück, denn sie töten die Männer im Morgengrauen) Obgleich ein stupider Text darauf folgte, wurde mir schaurig, denn mir erschien es wie ein von Maracas, den Rumba-Rasseln begleitetes Responsorium, dem ich zuhörte, während Maschinengewehraugen den Bürgersteig beobachteten.
Santiago de Cuba
Es regnete in Strömen, und das Flugzeug schaffte es nicht, die Landebahn anzupeilen. Nach mehreren Versuchen, die immer in einem ruckartigen Aufstieg endeten, landeten wir endlich. Es war zehn Uhr abends. Die eigentliche, angekündigte Ankunftszeit war 20.45 Uhr gewesen. Da es schon so spät war, wurde es schwerer für mich, noch ein diskretes Hotel aufzusuchen. In Santiago standen Passagiere an den Vestibülwänden, nicht die Agenten wie in Havanna. Inmitten des Salons voller heißer Luft, die der Regen hineingetragen hatte, überwachte ein halbes Dutzend uniformierter Männer in Guayaberas misstrauisch die Hotelangestellten, wie sie die Koffer durchsuchten.
»Du bist doch Ausländer. Oder?« fragte mich eine kalte Stimme hinter meinem Rücken. Als ich mich umdrehte, sah ich einen grinsenden Mann, der so tat, als hätten wir uns schon seit längerer Zeit unterhalten. »Ja.« Ich konnte es nicht verneinen. »Gut«, sagte er in demselben kalten Ton. »Es wäre vorteilhaft für dich, wenn du diese schwarze Jacke und die Krawatte ablegen würdest. Du erregst zuviel Aufmerksamkeit.« »Danke.« Ich versuchte zu lächeln und einen ebenso freundschaftlichen Ton anzuschlagen. »Ich habe dich mit deinem Freund am Flughafen gesehen. Das war leichtfertig.« Ich fasste den Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen: »Nun, … er ist der einzige, den ich kenne.« »Und hier?« fragte er. »Ich werde heute nacht in ein Hotel gehen. Morgen sehe ich weiter.« »Wenn du dich in ein Hotel begibst, werden sie dich fassen.« Genau in diesem Augenblick durchsuchten sie meinen Koffer. Er stellte seinen Koffer neben meinen, so dass sie fast zeitgleich mit uns beiden fertig waren. »Ich werde dich heute Nacht zu mir nach Hause mitnehmen. Mein Auto parkt hier in der Nähe.« Sekunden später, inmitten des Regens, machten wir uns ohne Hast auf den Weg in die Stadt. Sie lag fast komplett im Dunkeln. »Sabotage«, erklärte er mir lässig.
Wir hielten vor einem für Santiago typischen Haus aus Holz mit Veranda. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass niemand zu sehen war, stieg er rasch aus. Mein Koffer blieb im Auto. Er erklärte mir, dass es nicht empfehlenswert sei, ihn bei Nacht herauszunehmen. All diese Vorsichtsmaßnahmen schienen mir eher einem Krimi zu entstammen. Zudem misstraute ich immer noch meiner Entscheidung. Im Inneren des Hauses, das mit Kerosinlampen beleuchtet wurde, waren mehrere Frauen, die meinen Begleiter empfingen, als wäre er vom Schlachtfeld zurückgekommen. Mich beachteten sie gar nicht, bis ich vorgestellt wurde. Die Frauen, seine Schwestern, verstanden sogleich, dass ich ein sehr spezieller Freund war. Noch bevor ich meinen Mund zur Begrüßung aufmachen konnte, wussten sie schon, dass ich Argentinier war.
»Journalist, nicht wahr?« Der Mann wurde ungehalten. »Ich habe dir gesagt, dass er ein Freund ist. Hör auf, Fragen zu stellen und erwähne niemandem gegenüber, dass er hier ist!« Die Frauen ließen ab, und ich gelangte zur Überzeugung, dass ich außergewöhnliches Glück gehabt hatte. Es war offensichtlich: Die Leute aus Santiago waren daran gewöhnt, dass diese merkwürdigen Freunde unangekündigt auftauchten und unangekündigt wieder verschwanden. Die Hausbewohnerinnen waren stolz darauf, mich bei ihnen zu beherbergen. Ohne weitere Vorsorge, aber in leisem Ton, berichteten sie mir und ihrem Bruder von den Ereignissen der letzten Tage. Die Liste mit Sabotageaktionen, Schießereien und den getöteten Freunden meines Begleiters war sehr lang. Der Mann war fünf Tage von zu Hause weg gewesen. Er hatte Vorkehrungen getroffen und seinen Sohn im Hinblick auf das, was noch kommen würde, nach Havanna gebracht. Währenddessen war der Generalstreik ausgebrochen. Schon einige Wochen zuvor hatte man die verstümmelte Leichen zweier Jungen, dreizehn-und vierzehnjährig, gefunden, die von Batistas Wachposten verschleppt worden waren. Die Eltern in Santiago wusste nicht mehr, wie sie ihre Kinder schützen sollten. Alle waren begierig, am offenen Kampf teilzunehmen. (…)
Der Weg in die Sierra Maestra
Während ich mit einem Jeep ohne Scheinwerferlicht nach Las Bocas fuhr, konnte ich nicht aufhören an unsere Jagdgewehrschützen zu denken. Eine Handvoll gutausgerüsteter Wachposten Batistas hätte sie einfach wegfegen können. Diese jungen Männer setzten tatsächlich ihr Leben aufs Spiel, um eine dieser perfekten, automatischen US-amerikanischen Waffen, die die Batista-Armee besaß, zu ergattern. Las Bocas war von einer Rebellengruppe besetzt, die sich kurz zuvor aus den Milizen formiert hatte, die in den Städten agierten. Als ich ankam, ging gerade die Sonne auf. Alle unsere Uniformen waren neu, auch die Waffen. Nach einer kurzen Geheimzusammenkunft der Offiziere entschieden sie über die Route, die sie nicht gut kannten, denn sie operierten zum ersten Mal in der Sierra. Mir wurden zwei Begleiter zugewiesen. Die beiden jungen Bauernsöhne waren über diesen Befehl nicht gerade begeistert, weil ihre Einheit gerade in den folgenden Tagen aktiv werden sollte. Ein Oberleutnant, der nicht aus den Milizen stammte, sondern aus der wirklichen Rebellenarmee kam, änderte unsere Route und teilte mir mit, dass der Weg sehr hart werden würde.
»Wie lange werden wir unterwegs sein?» fragte ich ihn, während ich mir die Uniform der Rebellen anlegte. »Wenn alles gut läuft, etwa zehn Tage …« Natürlich hatte ich nicht im geringsten vermutet, dass der Weg derart lang sein könnte. Ein zehn Tage langes Bergauf und Bergab stand mir bevor. Ich sah um mich, die Berge ragten vertikal empor. Nirgendwo war ein Pfad zu sehen. Der Leutnant lächelte mir zu und eröffnete mir in einem etwas väterlichen Ton: »Dies ist noch nicht die Sierra Maestra, sondern nur die ersten Anhöhen.« – »Tja, was soll man machen … vorwärts!« sagte ich lakonisch. Dennoch amüsierte mein ziemlich resignativer Ton die Männer, die mich seit meiner Ankunft umringten. (…)
Meine zwei Begleiter waren schon fertig und erwarteten nur noch den Befehl zum Aufbruch. Für die zehn Tage hatten sie in ihre Rucksäcke einige Dosen, Milch und Birnensaft, Tabak und Streichhölzer eingepackt. In einem gelben Lederrucksack trug ich mein Aufnahmegerät, die Kamera und Filme. »Nun gut. Alles fertig!« befahl Milán. Im letzten Moment machte er mich darauf aufmerksam, dass ich keine Kappe hatte. Da keine mehr übrig war, gab er mir seine. »Das passt, mein Lieber. Viel Glück, ›che‹¹, und möge Gott dich begleiten.« Er umarmte mich kräftig, und die anderen klopften mir kumpelhaft auf den Rücken. Noch verstand ich nicht, dass dies zwar ein verhalten feierlicher, aber zugleich beängstigender Moment war. Ich hatte noch nicht die Flugzeuge erlebt, die ihre Brandbomben auf die Sierra fallen ließen. Und die Maschinengewehrgarben, mit denen auf wirklich alles, was sich auf den Bergpfaden bewegte, geschossen wurde, kannte ich auch noch nicht. Ich hatte weder die angezündeten und vollständig niedergebrannten Dörfer noch die von Maschinengewehrsalven durchsiebten Leichen der Bauern gesehen, die an den Bäumen baumelten. Noch hatte ich den grausamen Krieg in der Sierra Maestra nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass nach nur einer Woche ein Batista-Bataillon alle Schützen, mit denen ich mich in der Nähe von Contramaestre unterhalten hatte, ausgelöscht haben würde, weil sie keine Waffen hatten.
Als Milán sich ein letztes Mal bei mir verabschiedete, drückte er mir einen gefalteten Zettel in die Hand. »Bewahren Sie ihn gut. Wenn irgend etwas passiert und Sie allein sein sollten, dann wird er Ihnen als Passierschein dienen. Verstecken Sie sich, wo Sie nur können, und nähern Sie sich bei Nacht irgendeiner Hütte. Keiner der Bauern wird Ihnen die Gastfreundschaft verweigern. (…)
»Flugzeug!« schrie einer der Bergführer. Beide rannten, um Schutz zu suchen. Jedoch suchten sie genau dort, wo man nicht geschützt war – auf der Hochebene mit farbiger Tonerde. Ich fand einen gefällten Baumstamm und kauerte mich, so gut es eben ging, zusammen, als schon der erste Feuerstoß erfolgte. Mir schien es so, als ob eine Bombe direkt über meinem Kopf detonierte. Es waren jedoch die acht Maschinengewehre, die ihre Salven abfeuerten, und deren Echo gleichzeitig zwischen der Bergen widerhallte. Das Flugzeug, das einem silbernen Insekt glich, welches durch eine hellblaue Matte raste, machte eine wundervolle Drehung und kehrte zurück. Noch einmal verlängerte und donnernde Feuerstöße. Als die Maschine endlich verschwand, stellten wir unsere kleine Karawane wieder her und blickten nach jedem zweiten Schritt nach oben.
»Ein Glück, dass sie uns nicht gesehen haben«, sagte Chino. »Und wenn sie uns nicht gesehen haben, warum haben sie dann gefeuert?« »Weil sie wissen, dass die Rebellen – auch wenn sie sie nicht sehen – immer da sind. Wenn sie uns gesehen hätten, dann hätten sie uns den ganzen Tag lang verfolgt und uns nicht in Ruhe gelassen. Es kann sein, dass sie dennoch Feuerbomben werfen.« (…)
Obgleich wir mehr Stunden als am Vortag liefen, überstand ich die Reise besser. Nichtsdestotrotz hatte sich an meinen Knöcheln Hornhaut gebildet, und meine Wollsocken klebten mit jedem Schritt an meiner Haut. Ich hatte keinen Bissen gegessen. Meine Bergführer hingegen hatten der Kondensmilch Wasser zugefügt und tranken circa zwei Liter. Auf der Route, der wir nun folgten, gab es keine Hütten. Außerdem blieben die Bergführer, die so schnell wie nur möglich wieder zu ihrer Kampftruppe zurück wollten, ständig auf dem kahlen Berg. Sie nahmen viele Abkürzungen. Nach ihren ersten Schätzungen würden wir erst in der Nacht in den Minen von San Miguel ankommen, aber wir waren schon um vier Uhr nachmittags wenige Kilometer von ihnen entfernt. Dies bestärkte uns, eine Weile in einer Hütte zu bleiben, wo man uns Kaffee und aromatische »Guineos« anbot, die ich »Bananitas« taufte, weil ich mir nie den Namen merken konnte. Die Bauern zeigten sich sehr erfreut. Seit einem Monat hatten sie nichts mehr von einer Präsenz der Wachen in ihrer Zone gehört. Über das, was sich zwei Tage zuvor, ungefähr acht Wegstrecken entfernt von hier, ereignet hatte, waren sie hingegen bestens informiert. Das ist eines der großen Mysterien der Sierra, welches ich nie ergründen konnte. Als ich die Bauern fragte, woher sie denn alles wüssten, lächelten sie nur verschmitzt und sagten: »Wir haben es im »Radio Bemba« gehört.« Dies war natürlich kein Radiosender, sondern ihre Bezeichnung für den Buschfunk. (…)
Der Terror Batistas
Die Bergführer hatten sich von der vorgegebenen Route entfernt, und wir kamen sehr viel schneller als geplant voran. Dennoch mussten wir an jenem Tag sehr vorsichtig weitergehen, denn wir würden an der Kaserne Pino de Agua vorbeikommen. Da wir über abgeholzte steile Berge gingen, gaben wir eine gute Zielscheibe ab. Dass die Kaserne ganz in der Nähe sein musste, wurde uns bewusst, als wir die großflächigen schwarze Flecken auf der Tonerde sahen: An diesen Orten hatten einst Dorfhäuser gestanden, bis die Wachen auf ihren Streifzügen jedes einzelne Haus zerstörten. In den Bergen versteckten sich noch verängstigte Nachbarn, die auf die Ankunft von Rebellen warteten, um sie um Tabak oder um eine Dose zu bitten. An jedem verwüsteten Ort fanden wir dasselbe vor: Die alten oder kranken Bauern, die nicht hatten fliehen können, um sich Fidels Leuten anzuschließen, erzählten klaglos von der Plünderung, dem Brand, dem Mord an ihren Söhnen. Wenn die Wachen keinen Mann im Hause vorfanden, demütigten sie die Frauen. Nur ein Streichholz, nur eine Sekunde genügte, um die trockenen Hütten mit all dem Hab und Gut, das die Batista-Wachen noch nicht gestohlen hatten, zu vernichten. Die Bauern berichteten einfach. Ihr Ton war beinahe gleichgültig, denn schon seit zwei Jahren wurden sie permanent drangsaliert, weil die Wachen der kubanischen Armee in jedem Bauern einen Rebellen sahen. An ihnen statuierten die Batista-Schergen ein Exempel, kamen aus ihren Kasernen, plünderten, mordeten. Es war ihre Art, sich dafür zu rächen, dass sie an Kämpfen teilnehmen mussten, zu denen sie eigentlich keine Lust mehr hatten, und dafür, dass sie unfreiwillig in ihren Kasernen eingeschlossen waren. (…)
Der Weg bis zu Che Guevaras Kommandantur barg ernsthafte Risiken, denn wir mussten sehr nah am Dorf Las Minas vorbeigehen, wo sich das Gut des Mörders Sánchez Mosquera befand. Llibre und Cucho ließen sich, sobald wir an einem Rebellenstützpunkt oder an Bauernhütten ankamen, informieren. An diesem Tag ging die Nachricht um, dass Sánchez Mosquera mit seinen Truppen ausgerückt und dabei war, bis nach La Otilia aufzusteigen. Als wir an einem Ort namens La Estrella ankamen, zweifelte niemand mehr daran, dass Sánchez Mosquera sich in unmittelbarer Nähe befand. Meine Begleiter stellten auch hier ihre Fragen und bestimmten danach ihr weiteres Vorgehen: »Gehen wir weiter!« Ich war nicht resigniert darüber, weitere Stunden auf der Suche nach Che Guevara und Fidel zu sein. Außerdem wusste ich dank meiner bisher spärlichen Erfahrung immerhin, dass die Regierungstruppen nicht bei sengender Hitze in der Sierra unterwegs sein würden. Sie bewegten sich immer in der Morgendämmerung. In La Estrella waren alle Menschen wegen der neuesten Nachrichten über die »Heldentaten« Sánchez Mosqueras alarmiert. Er hatte das gesamte Dorf El Cerro angezündet und mehrere Frauen umgebracht, weil er sie ohne ihre Ehemänner vorfand, die nun den rebellischen Gruppen angehörten. Als wir unsere Route bis nach El Masío, obligatorischer Zwischenstopp auf dem Weg nach La Otilia, fortsetzten, gab man uns allerlei Ratschläge. (…)
»Weshalb bist du hier?«
Guevara traf um sechs Uhr ein. Erstaunt beobachtete ich eine Gruppe von jungen Männern, wie sie etwas taten, was ich schon seit einiger Zeit nicht mehr getan hatte: Sie reinigten ihr Gesicht. Verschwitzte Gruppen von Rebellen kamen mit ihren leichten Rucksäcken und ihren schweren Ausrüstungen beladen aus verschiedenen Richtungen. Ihre Hosentaschen waren voller Munition, und ihre Patronengurte kreuzten sich auf der blanken Brust, weil ihre Hemden keine Knöpfe mehr hatten.
Es waren die Leute, die den Truppen Sánchez Mosqueras in der Nacht zuvor einen Hinterhalt gelegt hatten. Erschöpft, müde und mit einer unterdrückten Wut auf die Wächter des verhassten Obersts kehrten sie zurück. Nach kurzer Zeit kam Ernesto Guevara. Er saß auf einem Maultier. Seine Beine hingen an beiden Seiten herab, und sein gekrümmter Rücken wurde vom Lauf einer Beretta und von einem Gewehr wie von zwei Stöcken verlängert, als ob sie seinen Körper stützten. Als das Maultier sich näherte, konnte ich erkennen, dass er einen ledernen Patronengurt trug, der mit Magazinen und einer Pistole bestückt war. Aus seinen Hemdtaschen lugten zwei weitere Magazine hervor, an seinem Hals hing eine Fotokamera. Sein kantiges Kinn zeigte einige Haare, ein Bart war das nicht. In aller Ruhe stieg er vom Maultier ab. Mit einem paar riesigen, schlammverschmutzten Stiefeln trat er fest auf die Erde. Während er sich mir näherte, schätzte ich, dass er etwa einen Meter achtundsiebzig maß und nahm an, das Asthma, an dem er litt, sei ihm wohl kein Hindernis.
Sorí Marín machte uns, die beiden Argentinier, vor zwanzig Soldaten bekannt. Da wir uns ziemlich gleichgültig begrüßten, enttäuschten wir sie. Der berühmte Che Guevara erschien mir als ein typischer junger Mann aus der argentinischen Mittelklasse. Er lud mich zum Frühstück ein, und wir aßen, fast ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Die ersten Fragen kamen von ihm. Sie bezogen sich auf die argentinische Politik. Meine Antworten befriedigten ihn wohl, und schon bald bemerkten wir, dass wir in vielen Dingen übereinstimmten und keine Bedrohung füreinander darstellten. Schon bald unterhielten wir uns weniger reserviert, und er duzte mich, obgleich wir als Argentinier ein und derselben Generation eine gewisse Distanz beibehielten. Ein Soldat, der versuchte, unserem Gespräch zu folgen, entlockte Guevara eine humoristische Bemerkung darüber, wie spaßig unser Akzent doch für die Kubaner war. Mir mussten beide lachen, das Eis war gebrochen.
Meine erste konkrete Frage an ihn, den jungen argentinischen Arzt, nun heldenhaften Kommandanten und Führer einer Revolution, lautete: »Weshalb bist du hier?« Er hatte seine Pfeife angezündet und ich meine Zigarre. Wir machten es uns bequem, denn wir wussten, es würde ein sehr langes Gespräch werden. Er antwortete mir in seinem ruhigen Ton, den die Kubaner für typisch argentinisch hielten, den ich jedoch für eine mexikanisch-kubanische Mischung hielt. »Ich bin aus einem einfachen Grund hier: Die einzige Art und Weise Amerika von Diktatoren zu befreien, ist, sie niederzuschlagen. Daran glaube ich. Man muss mit allen Mitteln zum Sturz beitragen und je direkter, desto besser.«
http://zambon.net/index.php?id=7&L=0