Das war so um die 1998
Grenzgänger
Umbruch für eine szenische Lesung in der Schweinehalle des Hanauer Schlachthofes, in dem das folgende „GRENZGÄNGER“-Kapitel spielt. Ruth Dröse-Fischer-Defoi hatte dazu eine hervorragende Rezension in der damaligen Frankfurter Rundschau geschrieben, die mittlerweile zur Abendpost/Nachtausgabe/BILD-Frankfurt für Besserverdienende verkommen ist.
Es roch nach geronnenem Blut, angesengten Borsten,
nach Schweinescheiße und Männerschweiß.
Ein schmieriger Film lag auf dem Asphalt, ein glitschiger dünner Brei aus Exkrementen, Knochenmehl, Innereien, Altöl, Benzin
und breitgefahrenen dürren, kleinen Pappelästen,
die der Frühsommerwind morgens aus den Bäumen geblasen hatte,
kurz bevor es anfing zu regnen.
Frühsommerwind war übertrieben. Ein sterbender Hauch vielleicht. Doch die Pappeln waren so erbärmlich dürr, daß sie auch ohne diesen Hauch jederzeit hätten kippen können.
Die schnelle innerstädtische Notbegrünung blätterte ab, wie der verrußte, ehemals bunte Anstrich in der düsteren Straßenunterführung nebenan. Sie starb ab wie die krebsgeschwürigen Linden in der Frankfurter Landstraße, durch die er gekommen war.
Daß es früher mal eine Allee war, konnte man gerade noch erkennen, wenn die heruntergelassene Bahnschranke den Weg zur Stadtmitte versperrte und die gottgegebene Zwangspause einen Blick durch die Fondscheibe ermöglichte.
Er hatte lange keine Schranke mehr gesehen.
In der Provence, der Bretagne, der Toscana, in den unterentwickelten Nachbarstaaten schon.
Aber in Deutschland nicht.
Er sah sich so plötzlich in die sechziger, beinahe in die fünfziger Jahre zurückversetzt.
Er rechnete fest mit dem pausbäckig stampfenden Vorbeibrausen einer Dampflock, wenigstens mit dem Vorbeirumpeln eines dunkelroten Schienenbusses
und war enttäuscht, als dann nur eine Diesellock mit einem endlos scheinenden Güterzug im Schlepp vorbeirauschte und -ratterte.
Der letzte Güterwaggon verschwand mit einem floppenden Geräusch zwischen den Bäumen der Kleingärten, die den Bahndamm säumten.
Der Taxifahrer ließ den Motor wieder an.
Jeden Moment mußten sich die Schranken öffnen.
Aber nichts geschah.
Gegenüber im Schrankenwärterhäuschen keine Bewegung hinter den matten Scheiben mit den ausgebleichten Vorhängen.
Offenbar war es unbesetzt.
„Automatische Schranke“, knotterte der Taxifahrer, ohne sich umzudrehen, “ die geht erst hoch, wenn der Zug im Bahnhof einfährt.“ Gleichgültiges Achselzucken. „Vielleicht lassen die auch noch einen Gegenzug durch.“
„Kann ich mal kurz aussteigen?“
Der Mann vor ihm nickte.
Dieses Anhalten war befreiend – wenn man es als Schicksal hinnahm und sich fügte.
Der abruppte Wechsel von der vierspurigen Autobahn auf die schmale Allee war ihm zu schnell gegangen. Die Bäume rasten an ihm vorbei und ließen ihm keine Zeit für die vergilbten unscharfen Bilder, die diese holprige Straße in ihm aufrüttelte.
Laufende Bilder waren es, mit eckigen Bewegungen und ruckender Kameraführung und dem krächzend schnarrigen Kommentarton eines frisch entnazifizierten Frontberichterstatters der jetzt bei der Fox Tönenden Wochenschau wiederverwendet mit seiner Sieg-Heil-heißergegrölten Stimme den kalten Krieg an der alten und neuen Ostfront anheizen durfte.
Schulwegathmosphäre.
Holzvergaser,
unzählige in den Wind gebeugte Schiebermützen auf ebenso unzähligen Adlerfahrrädern.
Oder waren es Wandererfahrräder
oder Opelfahrräder?
Kartoffelsäcke über den Querstangen.
Krückenbestückte ovale Schildkappen,
die den Volkssturm überlebt hatten.
Kopftücher im Joch der Leiterwagen.
Henkelmänner, Hinkemänner, Trümmerfrauen.
Schwarzmarktschieber und Kohlenklau.
Die Lok pfiff zweimal. Bremsen kreischten.
Das Zeichen zum Sturm auf Briketts, Koks und Eierkohlen
Apfelsinen werfende Amilaster
trieben laut hupend ein Pferdegespann vor sich her.
Echte Neger lachten breit aus den Türmen ihrer Panzer.
Kaugummisammelnde Kinder.
oder waren es Kippen
oder CocaCola-Kronkorken?
Und er mitten drin.
In kurzen Hosen und Kniestrümpfen
mit Kochtopfhaarschnitt und Rotznase.
Er nutzte die seltene Gelegenheit, sich ungefährdet mitten auf die Straße stellen zu können, fühlte -sich streckend- den leichten, wohligen Kitzel der vorsätzlichen Verletzung der Straßenverkehrsordnung, bis ihn der schwitzend wichtig und gewichtig heraneilende Schutzmann wild gestikulierend von der Fahrbahn jagte. Die uralte Angst beim Äpfelklauen vor dem Feldschütz. Gleich kommt er um die Ecke.
Er drehte sich um.
Hinter dem Taxi hatte sich eine Autoschlange gebildet, die bis zur nächsten Kreuzung reichte.
Jeden Augenblick mußte der dicke fette Unkerich, der Krötenpolizist aus Lurchis Abenteuern, auf der Kreuzung erscheinen und den Verkehr regeln.
Kein Wunder, daß hier die Linden eingehen.
Die Alleeränder sahen aus wie skorbuttgelichtete Zahnreihen.
Die frisch gepflanzten dünnen Lückenbüßer waren zum Teil schon den schnellen Kindstod gestorben.
Die Überlebenden hatten kaum eine Chance so alt zu werden wie ihre stoßstangenverbeulten krebsgeschwürigen Eltern.
Und trotzdem gefiel ihm diese Allee.
wie die schattenspendenden Hohlwege, die bei Schulwandertagen Sonnenbrand und Durst erträglich werden ließen: hinter der nächsten Biegung fängt das Dorf an, plätschert ein Brunnen, gibt es einen Laden, einen Kiosk. Kein Geld aber endlich Wasser. Trinken. Kühl streichelt es naß über die gepeinigte Haut. Die Augen schließen und ausruhen. Für kurze Zeit den ausgedienten Unteroffizier vergessen. Schuhe aus! Füße baden, Gesicht und Hände waschen! In Zweierreihe aufstellen! Der Kommandoton des wanderstockschwingenden Riegenführers beendet das Wonnegefühl, bevor die Gänsehaut aus Wasser, Wind und Sonne zu wohligem Dösen werden kann und zu Wünschen nach weiterem, weicherem Sreicheln.
„Steigen Sie ein, ich fahre über die Phillippsruher Allee.“
Das Taxi wendete, die Autoschlange hinter ihnen hatte sich bereits nach rückwärts in die Seitenstraßen verkrochen.
Die Linden an der leeren Frankfurter Landstraße mit der geschlossenen Schranke konnten aufatmen und für Minuten schienen die fünfziger Jahre tatsächlich zurückgekehrt.
Peter Kammer hatte seinen hellen Trenchcoat übergeworfen, die Reisetasche und das Case hinter sich unter die Laderampe ins Trockene gestellt.
Um neunuhrdreißig, als er aus dem Taxi stieg, hatte er den Mantel nicht angezogen. Da schien die Sonne noch, nicht sonderlich klar, doch sie machte den Eindruck als könne sie sich schnell gegen den Morgennebel über der Stadt durchsetzen.
Da hatte er zum ersten Mal echte Reiselust verspürt.
Eine Fahrt ins Blaue würde es nicht werden
eher ins Ungewisse.
Keine seiner üblichen Dienstreisen.
auch keine Abenteuerreise.
Die Grenzerfahrung reizte ihn, die geographisch-politische und die persönliche.
Er wußte nicht genau, worauf er sich einlies.
Aber das war in seinem Job nicht selten der Fall.
Er war immun, man kannte ihn, er hatte international einen guten Ruf als Journalist und notfalls auch die „Schutzbriefe“ des Senders. Außerdem waren die jeweiligen deutschen Botschaften stets darüber informiert, wo er sich gerade befand.
Kammer liebte das Risiko –
mit Rückversicherung.
Jetzt stand er im Nieselregen unter dem Wellblechvordach der Schweinehalle.
Er fing an, auf und abzugehen.
Seine Schritte hinterließen immer neue regenbogenfarbige Flecken auf dem Asphalt, die sich verformten, ausbreiteten, wenn er die Füße aufsetzte und einschrumpften, wenn er die Füße hob.
Kammer fand kindliches Gefallen an diesen Farbspielen.
Er probierte Wiegeschritte, begann fast zu tanzen.
Reinhard Mays Hymne auf den Frankfurter Flughafen pfiff ihm dabei durch die Zähne.
Ohrwürmer überbrücken Zeitlöcher: „…eine Pfütze Kerosin schimmert wie ein Regenbogen…“
Dieses Camälion, dachte Kammer, vom sanften Rebellen auf der Burg Waldeck zum Minnesänger für die Startbahn West.
Und er selbst?
Wetterfühlige Grübelei.
Seinen Tänzelschritt fand er plötzlich kindisch.
Er hielt inne.
Die ölige Feuchtigkeit kroch durch die Schuhsohlen über die Socken unter seine Kordhosen. Er zog sie etwas hoch, denn er befürchtete, sein Anzug könnte den penetranten Schlachtereigeruch aufsaugen und in den nächsten Tagen nicht mehr loswerden.
Die Reiselust war verflogen.
Die Ausdünstungen des Schlachthofes, vermischt mit Kautschukindustriegerüchen, legten sich auf seine Lungen. Inversionswetterlage, schlapper Luftstrom aus Südost.
Die Sonne heute morgen war trügerisch gewesen.
Er sträubte sich gegen den Smog, gegen die schmierig-fahle Einfärbung seiner Umgebung.
Nicht nur der Asphalt, auch die Wände der Schlachthofgebäude waren mit dem schmutzig grauen Film überzogen.
Vielleicht lag es an seiner Brille?
Kammer nahm sie ab, griff reflexartig zur Brusttasche seines Anzuges nach dem obligatorisch orangefarbenen Taschentuch –
Er griff ins Leere.
Er hatte es in der Eile des Aufbruchs heute morgen vergessen einzustecken.
In der Manteltasche fand er eine Packung Tempotaschentücher.
Er hauchte die Brillengläser an, putzte sie sorgfältig und setzte die Brille wieder auf.
Vergeblich.
Er nahm die gegenüberliegenden Gebäude immer noch wahr wie durch eine Mattscheibe.
Ohne die Brille erneut abzusetzen rieb sich Kammer die Augen.
Doch auch jetzt blieb alles matt.
Eine Mattigkeit, die seinen Gemütszustand belagerte.
Kammer merkte, wie in ihm ein eigenartiges Bedürfnis hochstieg. Seine rechte Hand klammerte sich in der Manteltasche um die Tempotaschentücher, Fensterputzen, Kachelnabspritzen, Hofkehren.
Zuhause hatte er den Hochdruckreiniger stehen…
Vom Sockel runter ist gut, dachte er,
aber das hier ging zu weit.
Er war nicht hierhergekommen, um sich im Hanauer Schlachthof einzurichten,
obwohl… man könnte ja…
Er dachte an den Frankfurter Schlachthof…
Zwei Putzkolonnen, etwas Farbe, Kleinkunstbühne, Lippmann und Rau… „Jazz in der Schweinehalle“, das klang gut.
In seinem Hinterkopf blätterte Peter Kammer in den Fotoalben der Endsechziger, der frühen Siebziger…
Und schlug sie abrupt wieder zu.
Ohne den verklärten Blick seiner Sturm- und Drangzeit sah er den öden Hof vor sich.
„Ich warte hier nur auf diesen gottverdammten Transport!“
Er fühlte sich als Fremdkörper.
Das war immer so, wenn der Ort nicht zu seinen Plänen paßte.
Doch er begann sich anzupassen, um den Ärger über nicht eingehaltene Terminabsprachen zu unterdrücken.
Peter Kammer hatte eine kaum überbietbare Anpassungsfähigkeit.
In seinem Kopf wuchs langsam das Gerüst für ein Feature über den Niedergang einer Industriestadt, über das Ausbluten des produzierendes Gewerbes in der Frankfurter Peripherie.
Naxos am Ende.
Milchwerke geschlossen,
Gummipeter vor dem Ruin,
Dunlop in der Krise.
Leybold-Heraeus baut ab.
Die Vacuumschmelze schmilzt dahin.
Mit Original Hanau geht es mainabwärts.
Er hatte die Sterberaten im Kopf.
Geisterstädte, nutzlose Immobilien, deren Grundstückswerte höher waren als die darin erwirtschafteten Gewinne der letzten Jahre, Jahrzehnte.
Makler beherrschten das Feld.
Die ganz großen Haie.
Der Schlachthof war Sinnbild für den Exodus.
Die leeren Fensterhölen, die staub- und fettverschmierten Glasreste in den Eisenrahmen ergaben ein herrliches Intro zu diesem Thema.
Das Script hatte er schon im Kopf.
Der Rest war Routine.
Nur Siemens und Degussa passten nicht in das Bild.
Auch Honeywell florierte.
Antizyclisch?
Warum gerade die?
Klar, Kernkraftwerke und Raketen.
Die Kernstücke der Bonner Subventionspolitik.
Strategische Pfeiler der Nato.
Wenn sonst alles ringsum in die Brüche ging, bei denen wackelte nie etwas, die hatten immer Schlachtfest. Vor dem Krieg, nach dem Krieg, im Krieg.
Antizyclisch.
Mit allen Mitteln. Mit Arisierungspogromen, Zwangsarbeitern, Fremdarbeitern.
Besonders Degussa, die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt.
Im Krieg Spezialist für das Einschmelzen jüdischer Goldzähne,
nach dem Krieg Spezialist für den Ankauf kriegsverwaister Eheringe und ausgebombten Familienschmuckes.
Deutsche Scheideanstalt,
das klang als Wort schon nach Auschwitz und Treblinka.
An der Rampe schieden die Kommandanten die Guten von den Schlechten, die einen in Zwangsarbeit, die anderen ins Gas. Verscheideanstalt.
Und wenn das Kanonenfutter, die Fronturlaubsfreier zum Abschied sangen: „Ade mein Schatz ich scheide“, dann war das die gleiche Scheideanstalt, die sie auch später bei Stalingrad singen ließ: „Winter ade, scheiden tut weh!“
Bis daß die Scheideanstalt euch scheidet, treu bis in den Tod.
Gold gab ich für Eisen. Im ersten wie im zweiten Weltkrieg. Kammer sah die gußeiserne Uhrkette seines Vaters mit der altdeutschen Inschrift deutlich vor Augen. Viel mehr war von ihm nicht übriggeblieben.
Und später?
Der Ertrag der Notverkäufe langte nach dem Krieg gerade mal für eine eiserne Ration. Was blieb, waren Mutterkreuze, Eiserne Kreuze, Holzkreuze und tausendfach nicht mal die.
Antizyclisch?
Zyclisch!
In dieser Stadt konnte man mit dem Zirkel von einem Wespennest ins andere stechen. Hier griff eins ins andere wie die Kettenglieder. Und egal, wo man anfing, man löste Kettenreaktionen aus.
Hier konnte er sich nicht nur die Finger verbrennen.
Die Familienglieder hielten zusammen, heute wie damals, als die Degussatochter Degesch, die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, das Zyclon-B lieferte, damit der Mutter Degussa auch ja kein Goldzahn entging. Bei der Taufe der Tochter standen die Großbanken Pate. Zyclon-B. ein Reportagezyclus über Geld, Gold und Gas. Genügend Material war vorhanden. Ganze Berge von Akten und Dokumentaraufnahmen. Bücher dazu gab es zu Hauf. Die las bloß keiner. Aber eine Sendereihe im Fernsehn für ein Millionenpublikum von Analphabeten? Kammer witterte das Risiko. Doch nach vierzig Jahren mußte es eigentlich möglich sein.
Er durfte nicht zu lange warten, sonst war mit diesem Themenbereich kein Blumentopf mehr zu gewinnen.
Die Konkurrenz stand wie er in den Startlöchern und hatte die gleichen Bauchschmerzen:
war der Konflikt mit den beteiligten Konzernen und Banken kalkulierbar, der Schaden begrenzbar?
Wieviele Werbespots würden storniert.
Würde die oberste Etage mitspielen.
Er wüßte sich zu verkaufen.
Die nachgewachsenen Banker und Manager müßten nur die Chance zur moderaten Vergangenheitsbewältigung erkennen.
Die Herren könnten wie Phönix aus der Asche steigen, die sie sich telegen auf die schuldbeladenen Häupter längst verstorbener Vorstandsvorsitzender streuten.
Sowas würde Märkte eröffnen, auf denen sich Siemens und Degussa immer noch nicht blicken lassen konnten oder zumindest schwer taten.
Willy Brandts Kniefall in Warschau war nichts dagegen.
Noch ist Polen nicht verloren,
das goldene Prag würde noch näher rücken
und der Standortvorteil der deutschen Industrie käme zur Geltung, bevor Franzosen, Amerikaner und Japaner auf dem gigantischen russischen Markt Fuß fassten.
Seine strategischen und taktischen Überlegungen mußten dabei unter dem Teppich der ehrlichen Vergangenheitsbewältigung, der Völkerverständigung bleiben.
An seiner integeren Position durften nicht die geringsten Zweifel nagen. Er durfte nicht nur links blinken, um dann nach rechts abzubiegen. Er mußte – so schwer es ihm fiel – seinem Image treu bleiben, um es langfristig gesichert zu ändern.
Ein Hupen riß ihn aus den Planspielen.
Kammer sprang zur Seite.
Der mürrische Blick aus dem Führerhaus des rutschend bremsenden Fleischtransporters traf ihn unvorbereitet:
Was hast du hier zu suchen? Hau ab!
Was habe ich hier zu suchen?
Sicher keine Niedergangsimpressionen, auch keine Vergangenheitsdepressionen.
Sozialkritische Reportagen, investigativer Journalismus waren früher und viel zu lange Kammers tägliches Brot gewesen
-bis zum Erbrechen.
Immer wieder kam er darauf zurück, so entschlossen und bewußt er sich davon verabschiedet hatte.
Es war ein Klotz am Bein, den man widerwillig mit sich herumschleppen mußte, an dem man seine Herkunft allzu leicht erkennen konnte. Dieser Ballast behinderte den unbeschwerten Seitenwechsel bei der Kameraführung, Einstellungen von der Siegerseite blieben meist ausgeblendet. Nicht, daß er sie nicht zeigen wollte, die Sieger verwehrten ihm den Zutritt.
Waren diese Überlegungen Bestandteile seiner journalistischen Sorgfaltspflicht oder Produkte seines Bedürfnisses nach persönlicher Vergangenheitsbewältigung, nach einem Schlußstrich unter die Regie-Ära der Verlierermentalität?
Noch viel zu oft mußte er seine spontanen Neigungen in diese Richtung unterdrücken,
wie aufsteigende Galle in der Speiseröhre.
Der bittere Geschmack machte ihm zu schaffen,
verfolgte ihn wie Mundgeruch bei Zahnfäule und Magengeschwüren. Dagegen half kein Odol.
Tiefe Einschnitte unter Narkose vielleicht.
Aber da wußte man nicht, ob Teile entnommen würden, die er noch brauchte, die sein besonderes Profil ausmachten.
Periodische Generalreinigungen waren ihm lieber, die waren weniger schmerzhaft und er konnte selbst bestimmen, wann Schluß ist.
Gründlich ausspülen.
Der Hochdruckreiniger stand im Keller, ohne daß er ihn jemals benutzt hätte. Als er ihn damals nach dem Kauf aus dem Kofferraum holte, war er fest davon überzeugt, daß er ihn niemals benutzen würde. Männerspielzeug für die Psychokiste. Waschzwang und Penisverlängerung. Daß er ihn trotzdem behielt, hatte mehr als porentiefe Gründe.
Kammer grinste.
Er war sich selbst auf die Schliche gekommen.
Sein Grinsen erstarrte. Er wußte daß er bei Expeditionen ins Innere dieses unbekannten Kontinents allein verloren war.
Verirrt in den eigenen Winkelzügen, Schiffbruch im Oberlauf seiner Gehirnwindungen?
Die Psychohygiene war nicht sein Job.
Wozu hatte er seinen Therapeuten?
Vielleicht sollte er ihm die bisher vermauerten Ebenen zugänglich machen.
Manchmal waren die Sitzungen spannende Machtspiele. Er wollte sich beweisen, daß er stärker war als sein Seelenklempner. Er ließ ihn nicht in jede Dreckecke vordringen. Das konnte er auch alleine.
Der Kerl kostete ihn ein Schweinegeld.
Genau genommen hielt er sich diesen Psychodienstleister wie römische Despoten sich ihre Hausphilosophen hielten.
Irgendwann würde er ihm standesgemäß den Schierlingsbecher reichen.
Despoten waren Angstbeißer.
Und er?
Es waren nicht nur Machtspiele. Er wußte, es gab fast vergessene Türen zu geheimen Kammern, die er nicht öffnen wollte, an denen er seinen Therapeuten und auch sich selbst vorbeitäuschte.
Wo blieb die Baronin?
Telefonieren?
Kammer konnte sich an keine Telefonzelle in der Nähe erinnern.
In der Schweinehalle?
In den Büros gegenüber?
Da herrschte gähnende Leere.
Die Fleischpacker hatten bestimmt ein Telefon hinter den undurchsichtigen Klarsichtschwingtüren am Halleneingang,
aber mit seinem Anzug traute er sich nicht zwischen die Schweinehälften.
Um Zehn Uhr sollte es eigentlich losgehen.
Er holte den Zeitplan aus dem Case, den ihm die Baronin nach Mainz gefaxt hatte.
Sollte er sich getäuscht haben?
Unmöglich.
Normalerweise konnte man am Lerchenberg nach ihm die Uhren stellen.
Kammer war berüchtigt für sein penibles Zeitmanagement.
Das war nicht immer so gewesen.
Aber seit seinem Wechsel nach Mainz hatte er keinen einzigen Termin platzen lassen, eine Tatsache, die ihm zusammen mit seiner Vorliebe für orangefarbene Hemden und Krawatten Mitte der siebziger Jahre den Spitznamen „Clockwork Orange“ eingebracht hatte.
Über ihm hing die große Uhr des Schlachthofes.
Er war sich nicht sicher, ob sie richtig ging.
Ein Fleischtransporter mußte sie angefahren haben,
sie hing nur noch an einer Strebe schief unter dem Vordach über der Laderampe.
Um die Telefonbau-Normal-Zeit mit seiner Longines zu vergleichen mußte Kammer entweder auf die glitschige Rampe steigen oder hinaus auf den Hof in den Regen.
Kammer blieb stehen.
Er hatte Zeit, wollte sie aber trotzdem nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Der Zeitgeiz steckte in ihm als langgedientem festen Freien,
dem das Honorar wie der Sand in der Uhr durch die Finger rann.
In seiner heutigen Position nahm er die Zeit,
er konnte sich Zeit nehmen, weil er die Zeit der festen Freien in seinem Stab nahm.
Aber er war stock sauer, er wurde böse, wenn ihm jemand seine Zeit nahm.
Gegenüber an der gelblichweiß gekachelten Wand des Verwaltungsgebäudes hatte bis vor kurzem noch eine weitere Uhr gehangen.
Der runde helle Fleck über der zerbeulten Eingangstüre starrte aus seinen leeren Dübellöchern zeitlos über den Hof.
Kammer mußte warten.
Er kam sich vor wie bestellt und nicht abgeholt.
War er ja auch.
Nach einem kurzen Anflug von Ungehalten sein – er war schließlich nicht irgendwer – entschloß er sich, das Warten zu akzeptieren, denn auch das gehörte zu seinem Beruf.
Die Baronin hatte ihn wochenlang am Telefon bekniet und ihm reiche journalistische Beute bei dieser Reise versprochen.
Nach langem Zögern hatte er äußerlich unwillig zugesagt und der Baronin dabei signalisiert, daß er für die gute Sache seine Freizeit, einen Teil seines Urlaubs opfern würde.
Mit seiner immerhin über zehnjährigen Erfahrung als Frontschwein beim Zweiten Deutschen Fernsehen hatte er einen Spürsinn für lohnende Storys entwickelt, besonders für solche,
auf die man keine Leute aus der zweiten Reihe ansetzen konnte.
Hier mußte man warten, beobachten, in großen Zusammenhängen denken, über Hintergrundwissen verfügen und oft vom Sockel steigen, Understatement pflegen, einen Fünftagebart, schlaflose Nächte, schlechte Hotels und Nieten riskieren, um im entscheidenden Moment die Nase vorne zu haben
auf Feldern die die Konkurrenz erst Tage oder Wochen später nachbeackern durfte.
Mit einiger Genugtuung stellte er fest, daß der Fünftagebart mittlerweile zum Markenzeichen für engagierten Journalismus avanciert war und bei den Frauen hoch im Kurs stand
– zumindest aus Entfernung.
Am Lerchenberg machte vor Jahren das Wort vom „Kammerbart“ die Runde.
Er mußte schmunzeln.
Während er sich schon längst wieder vom Fünftagebart verabschiedet hatte,- spätestens seit er jedes zweite harte Männermodel zierte -, ließen sich in Mainz alle Nobodys reihenweise die Stoppeln im Gesicht stehen.
Er, Kammer, wollte sich nicht auf das Image des „linken“ Journalisten festlegen lassen.
Er mußte flexibel bleiben zwischen Anti-AKW-Demos und Opernbällen, zwischen Alternativen Listen und Auswärtigem Amt,
zwischen K-Gruppen und Kanzlerrunden, autonomen Chaoten und Automobilkonzernen, zwischen Ökologen und Ölmagnaten
Kammer war für Überraschungen gut.
Kammer kam überall hin und überall an.
Er war ein professioneller Grenzgänger mit der Psyche eines Doppelagenten, der seine Berichte aus allen Positionen schreiben konnte.
Auch für alle.
Die Recherchen im Vorfeld fielen ihm leicht.
Das abgeschlossene Studium in Politologie, Soziologie und Volkswirtschaft war schon seit Beginn seiner Journalistenkarriere die entscheidende Grundlage dafür, daß er politische Entwicklungen in ihren Keimformen orten konnte.
Kammer fühlte in sich immer noch den alten Pioniergeist, den ihm seine Lehrmeister eingebleut hatten, deren Glanz er bis zu seinem Wechsel zu Adenauers Staatsfernsehen nicht erreichen konnte.
Seit dem Umzug aus dem Frankfurter Barackenprovisorium auf den Lerchenberg nach Mainz hatte er sich einigermaßen freigeschwommen aus dem Windschatten der Politmagazin-Giganten der ARD.
Nie wieder Aktentaschen- und Zuträger!
Wie zur Allegorie seiner Gedanken geronnen, öffneten ehemals weißbekittelte blutbeschmierte Fleischpacker den Kühltransporter, der ihn vorhin beinahe über den Haufen gefahren hatte.
Ein Packer sprang in den Laderaum und kippte aus dem Kühlnebel eine Schweinehälfte nach der anderen auf die unten Wartenden, die sie durch den Nieselregen an ihm vorbei in die Halle schleppten.
Er hörte den schweren Atem der Männer, deren Gesichter er im Schatten ihrer Kapuzen nicht erkennen konnte.
Sie trugen die halbierten Tierleichen wie große Kruzifixe schweigend über den Hof.
Eine gespenstige Prozession.
Die Fleisch gewordenen Mönche
aus Umberto Ecos „Im Namen der Rose“.
Ein Albtraum.
Um ihn abzuschütteln vollführte er einen Kameraschwenk
Die langgestreckten Gebäude rings um den Hof erinnerten Kammer weniger an ein mittelalterliches Franziskanerkloster.
Aus nicht gleich entschlüsselbaren Gefühlen mußte er an das alte Funkhaus in der Frankfurter Bertramstraße denken.
Vielleicht waren es die gelblich weißen Kacheln, die Säulen, die endfünfziger Flachdachkonstruktionen, die Metzgerei- und Schlachthofstatik des frühen Wirtschaftswunders.
Kühner Höhe- und mutiger Kontrapunkt:
die nierenförmigen Vordächer über den Eingangstüren.
Kammer sah das Konferenzzimmer vor sich mit staaksigen Polstersesseln und Tulpenleuchtern an den Wänden, Dynamik vortäuschende, angeklebte Feigenblätter, die die Herrschaft der Quadratschädel und die visuelle Allmacht der rechten Winkel und Rechtecke nicht verstecken konnten.
Und wohl auch nicht sollten.
In Frankfurt waren sie die zwingende Kulisse für „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ und hier das notwendige architektonische Rahmenprogramm für „Nordfleischs gesammelte Schweinehälften“.
Es bestand ein atmosphärischer Zusammenhang, der sich hinzog bis zum Lerchenberg, geographisch, geometrisch, ästhetisch, architektonisch und politisch.
Der Unterschied lag nur in der Dimension:
der Lerchenberg wirkte wie ein europäischer Zentralschlachthof.
Wie lange hatte er als fester Freier die Schweinehälften getragen, die Knochenarbeit für die im Rampenlicht gemacht, politische Schweinereien aufgedeckt und ausgeschlachtet und den Stars zur Präsentation mundgerecht serviert. Und wie oft mußte er journalistische Schweinereien ausbaden und auslöffeln, die er nicht angerichtet hatte.
Kammers mittlerweile zur zweiten Natur gewordene Gelassenheit war noch nicht stabil, sein dickes Fell war hauchdünn.
Immer lauerte darunter die panische Angst davor, in die zweite Reihe, in das anonyme Heer der freien Mitarbeiter zurückzufallen.
Feste Freie, welch eine herrliche Perversion der Sprache.
Die herrschenden Sprachregelungen sind die Regelungen der Herrschenden, hätte er vor fünfzehn Jahren noch kommentiert.
Den gelegentlichen Rückgriff in den linken Katechismus brauchte er, wie die Alten das Absingen von Kirchenliedern und Gebeten in existenziellen Situationen in Luftschutzkellern und Schützengräben.
Manchmal brauchte er diese Zugriffsmöglichkeit, um sich den Zugang zum Spektrum der linksradikalen Randgruppen zu erleichtern.
Sprache als Köder.
Sprache als trojanisches Pferd.
Sprache als Nebelwerfer.
Heute trug er selbst in seinen Sendungen ein gutes Teil dazu bei. Und nicht nur dort, auch in seiner alltäglichen Sprache.
Warum nannte er seine Leute im Stab bis auf wenige Ausnahmen „Nobodys“?
Er sprach nicht nur so, er dachte so.
Kammer wußte, daß seine Wortwahl oft schon kein taktierendes Zugeständnis an Sprachmoden, an Sprachkonjunkturen mehr war,
wie früher, als er sich über bestimmte Jargons an seine journalistischen Opfer heranmachen mußte.
Feste Freie.
Es hatte Jahre gedauert, bis er sich mit Hilfe wechselnder Beistände aus den konkurrierenden Journalistenverbänden im Dschungel der Verträge und Tarifbestimmungen zurechtfand.
Heute war ihm das egal.
Aber bei seinem Einstieg wußte er lange nicht, mit welchen Rechten und Pflichten er in welchem Vertragsverhältnis zum Sender stand. Bis heute war das vielen auch in seinem Stab nicht völlig klar.
Es gab feste Mitarbeiter, fast schon Beamte, mit einigermaßen gesichertem aber dafür schlechtem Einkommen, die gehörten zum Funkhaus wie das Inventar. Die Leute von der Technik, die Kameraleute, die Beleuchter, ohne die konnte der Laden nicht laufen, obwohl sie immer als träge Masse von oben wie von unten beschimpft und bedrängt wurden.
Und da waren die Stars, die ständigen Freien Mitarbeiter, die auf die feste vertragliche Bindung mit dem Funkhaus pfiffen und pfeifen konnten, weil sich die Konkurrenz um sie riß, die immer auf dem Sprung waren oder zumindest so taten.
Und zuletzt, knapp vor den Putzfrauen und den Pförtnern,
die festen Freien.
Die festen Freien
Sie waren weder fest noch frei.
Fest nur insofern, als sie fest an den Sender gebunden waren, der sie bei längeren Ausfällen schnell ersetzen konnte.
Die Bewerberlisten waren endlos.
Und frei?
Frei von sozialer Absicherung.
Frei von gesichertem Einkommen.
Frei, jederzeit zu gehen.
Er kannte dieses Elend, aber für ihn war es der Schnee von Gestern, er hatte das rettende Ufer erreicht, seinen Hafen gebaut und relativ festen Boden unter den Füßen. Als gefragter Autor, als selbständiger Produzent, als informeller Ressortchef und ständiger freier Mitarbeiter.
Und das war etwas völlig anderes als ein „fester Freier“.
Das war die Freiheit die Kammer meinte.
Er hatte sich hoch geboxt.
Nicht mit Brachialgewalt.
Mit klarer langfristiger und flexibler Strategie, mit Marktüberblick, mit taktischer Raffinesse und der Fähigkeit, unumgängliche Hindernisse durch kaum spürbare Kurskorrekturen zu überwinden.
Daß die „festen Freien“ seines Stabes am Lerchenberg mittlerweile offen „Kammerdiener“ genannt wurden, störte ihn einerseits, andererseits war das auch eine Art Anerkennung, Bestätigung seiner unangefochtenen Spitzenposition.
Das Aufheulen eines Motors riß ihn diesmal rechtzeitig aus den Gedanken. Er ging einige Schritte zur Seite, als der Kühlwagen rückwärts losfuhr, wendete und mit quietschenden Reifen vom Hof preschte.
Die plötzlich eingetretene Ruhe störte ihn.
Kein Mensch war zu sehen,
kein LKW,
der Hof war leer.
Kammers Geduld neigte sich ihrem Ende zu.
Er vermied es, auf die Uhr zu sehen.
Nur nicht nervös werden!
Ihm war nicht wohl in seiner Haut.
Er schob es auf das Wetter.
Das gelang ihm nur unzureichend.
Er kannte sich zu gut.
Er hatte sich selbst verunsichert.
Ungeplante Momente unter unangenehmen Bedingungen, wie dieses Warten, stürzten ihn in spiralförmig sich ausdehnende Selbstzweifel. Er haßte die zur Routine gewordene Selbstkritik, die er über sich ergoß, um sich von seiner schleimigen Standpunktlosigkeit reinzuwaschen.
Kammer drohte sein Selbstbewußtsein in den verklebten Gulli in der Mitte des Hofes zu spülen.
So sehr er sich wünschte, daß endlich die Baronin mit ihren LKWs auftauchte,
jetzt durfte niemand kommen, den er kannte.
Er mußte sich erst wieder fangen.
Aber je mehr er sich fangen wollte, um so weniger gelang es ihm. Er tauchte ab in die erniedrigendsten Niederungen seiner Journalistenlaufbahn.
Die schlimmsten Episoden schossen ihm durch den Kopf:
jedesmal, wenn er mit seiner Ende der Siebziger Jahre frisch gegründeten Produktionsfirma einen Flopp produzierte, machten die Flüsterwitze der Festangestellten im Ressort Politik an den Stammtischen die Runde:
„Was machen die Kammerjäger, wenn sie auf Großwildjagd gehen? Sie blasen Küchenschaben zu Krokodilen auf und Eintagsfliegen zu Elefanten!“ Die Leute in seinem Stab waren die „Kammerjäger“.
Seine Reportagen nannte die Konkurrenz „Kammerspiele“ oder „Zimmertheater“, also nicht authentisch, – inszeniert und konstruiert.
In Anspielung auf seine Gesichtsform und seinen Hang zur guten Nachricht, die jeder Katastrophe noch eine versöhnliche Seite abgewann, nannten ihn die Kollegen schon in Frankfurt nur den „Guten Mond“ in Anlehnung an Matthias Claudius‘ Vers von der „stillen Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.“
Ende der sechziger Jahre bis in die Siebziger hinein war er diesem Spott andauernd ausgesetzt.
Er hatte sich noch nicht ausreichend gepanzert.
Daß er sich in seiner Verletzbarkeit einem Kollegen anvertraute, war dann der Scheitelpunkt der Entwicklung beziehungsweise das Ende der Talsohle.
In der Baracke und anfänglich noch auf dem Lerchenberg wurde er zunächst als „Jammerkammer“ gehandelt.
Als er damals in Zusammenarbeit mit amnesty international eine Sendereihe über Folter produzierte, hatte er sich den Markennamen „Folterkammer“ eingefangen, was ihn aber schon mehr aufbaute als verletzte.
Über wen gespottet wird, der bleibt in der Diskussion, dessen Marktwert steigt, wenn er sich nicht unterkriegen läßt.
Kammer konnte mit den Jahren viel aushalten und viel aussitzen.
Er war nicht sonderlich stark aber unheimlich zäh geworden.
Nicht hartnäckig – was Rückgrad und Linie bedeutet hätte.
Kammer war nicht zu fassen, amorph wie eine Amöbe, glitschig wie ein Aal. Eigenschaften, die sich immer erst offenbarten und ihre Nützlichkeit erwiesen, wenn er mit dem Rücken zur Wand keine Hintertüren und Notausgänge entdeckte, um sich äußerlich unangeschlagen aus unangenehmen Situationen und Affairen davonzuschleichen.
Kammer fröstelte.
Er hatte den Eindruck als regnete es nur auf diesen paar Quadratmetern Asphalt und nur, weil er hier wartete.
Dieser Hof hielt ihn gefangen
mobilisierte seine Urängste
schien auswegslos.
„Kammer, reiß dich zusammen. Kneif dir ins Ohr. Wach auf. Du weißt wer und was du bist. Vor dir liegt eine wichtige Aufgabe, die keiner außer dir bewältigen kann. Konzentriere dich auf deinen Plan oder auf einfache Dinge, auf das Nächstliegende, auf real Greifbares!“
Selbstwertkonditionierung.
Manchmal war der Therapeut doch zu etwas nutze.
Bescheuert genug, daß er so was nötig hatte.
Er verlegte sich auf das Beobachten der Schlachthof-Randbebauung.
Das war nächstliegend genug – allerdings nicht gerade einfach.
Hinter den Pappeln an der Nordseite des Hofes erhob sich ein imposanter bewohnter Provinzkasten mit zehn Stockwerken. realsozialdemokratischer Plattenbau mit Nachtspeicherheizung, asbestgesättigt, eine verjährte hundertfache architektonische Körperverletzung.
Auf der Südseite grüßte über die Schlachthofmauern hinweg eine Marmorwand mit stark verrußter Neonschreibschrift.
Sie verkündete für Halbalphabeten leicht les- und für Steinwürfe schwer erreichbar trotzig defensiv: „Marmor ist kein Luxus“.
Ein solcher Werbespruch konnte eigentlich nur in dieser Stadt entstehen. Der Entwurf mußte aus den fünfziger Jahren stammen, als Hanau noch ein tief rotes Pflaster war.
Plötzlich fiel ihm die Adresse wieder ein, die er dem Taxifahrer beim Einsteigen zugerufen hatte.
Kanaltorplatz.
Er stand auf historischem Boden.
Hier hatten die Hanauer mit dem Sturm auf das Zollamt achtzehnhundertdreißig die Revolution eröffnet. Und der Marmorladen war keinen Steinwurf davon entfernt.
Damals wurden die großen Vieh- und Kornhändler angegriffen und die Büros der Zolleintreiber zerstört.
Zoll? Kammer wurde aus der Historie in die Gegenwart geschleudert: würde der Zoll seine Kamera und sein Tonbandgerät beschlagnahmen? Gab es im Kriegsrecht entsprechende Erlasse? Konnten die Milizen im Ausnahmezustand ihm die Sachen einfach wegnehmen, würden sie ihn der Spionage verdächtigen. Vor der Abfahrt mußte er das mit den westdeutschen Zollbehörden noch abklären. Besser noch beim Auswärtigen Amt oder bei der Botschaft. Freitagmittag, die Zeit war äußerst ungünstig. Sicher wußte die Baronin über die Bestimmungen bescheid. Die anderen Mitfahrer wollte er nicht fragen. Er wollte sich ihnen möglichst nicht offenbaren. Die Baronin hatte ihn vorgewarnt: „eine ziemlich bunte Truppe: Betriebsräte, Gewerkschaftler, Sozialdemokraten, Christen und Kommunisten, Ärzte und Krankenschwestern.. aus Hanau und Umgebung“.
Was sich da zusammengefunden hatte, war ihm sehr suspekt.
Und daß die Baronin nicht wußte mit wem sie es zu tun hatte, merkte Kammer schon daran, daß sie von Gewerkschaftlern statt von Gewerkschaftern sprach. So war sie eben. Für ihre Ziele verbündete sie sich, wenn es sein mußte mit Tod und Teufel.
Einer solchen Mischung mußte er mit Vorsicht begegnen, besonders, wenn sie aus Hanau kam.
Etwas Geschichte hatte er als Politologe auch studieren dürfen.
Die Stadt hatte eine rebellische Tradition von 1848 über 1918 bis 1948 und darüber hinaus.
Hanau war bis neunzenhundertdreiunddreißig eine Hochburg der USPD und der Kommunisten, und nach dem Krieg regierten hier Sozialdemokraten und Kommunisten zusammen. SPDler konnten nur etwas werden, wenn sie irgendwie eine kommunistische Vergangenheit, Kontakte in die sowjetisch besetzte Zone oder Verfolgung durch die Nationalsozialisten nachweisen konnten.
Ein Hanauer Ex-Kommnunist war bis 1948 Oberbürgermeister und wurde dann Hessischer Innenminister.
Kammer erinnerte sich an eine Recherche aus seinem Stab über sozialdemokratische Funktionsträger im Dunstkreis der Hanauer Atomfabriken. Besonders das Material zum „fliegenden Holländer“ hatte ihn damals gereizt, die Geschichte eines Provinzjournalisten und sozialdemokratischen Aufsteigers aus der altlinken Ecke, mit zahlreichen Ostkontakten und starkem Flugreisebedürfnis. Den hielt sich die Atomlobby als Bundestagsabgeordneten und Europapolitiker. Doch die Recherche war nicht ausgereift und schließlich durchgefallen. Die mangelnde Reife war jedoch damals nicht der Grund sie durchfallen zu lassen. Sie war politisch nicht opportun, hätte falsche Fronten aufgebaut und Informationskanäle verstopft.- Das Material lag im Archiv, Kammer hatte das Gefühl es noch einmal verwenden zu können: der Holländer war die Inkarnation der Entwicklung der Sozialdemokratie: mit linken Sprüchen unten Stimmen fangen, um sich dann nach rechtsoben abzusetzen.
Erst in den sechziger Jahren bröckelte die alte linke Tradition in dieser wie in vielen anderen Städten ab, bis ihre Reste in Wohnbunker, Parkhäuser, Großkraftwerke und Plutoniumbunker einbetoniert wurden, in Gesamtschulen und Schlachthöfe wie diesen, quatratisch, statisch und sozialdemokratisch bestückt mit Kopfnickersitzen im Aufsichtsrat.
Alles Auslaufmodelle der siebziger Jahre.
Kammer hörte von weitem schon die Abrißbagger, das Dröhnen der Abrißbirnen, die dumpfen Detonationen der Sprengladungen.
Diese Architektur verdiente keinen anderen Abgang.
Die dazugehörigen Specknacken auch nicht.
Drei fettsträhnige Nordfleischgestalten begannen den Hof zu säubern. In kniehohen Gummistiefeln, der eine mit Wasserschlauch, die beiden anderen mit Besen bewaffnet, umzingelten sie Kammer, drohten ihn, das heißt, was von ihm noch übrig war, vom Hof zu spülen und zu kehren.
Klar, es war Freitag. Kammer dachte über die seltsamen Hygienevorstellungen dieses Betriebes nach.
Deutsche Tugend: zum Wochenende muß der Laden blitzblank sein, gerade dann, wenn hier kein Schwein mehr rein kommt.
Ihm reichte es.
Bevor die ihm den Anzug und den Mantel ruinierten, setzte er sich lieber ab.
Die Gefahr, daß er den Transport verpaßte war äußerst gering.
Die Baronin war scharf darauf, daß er mitkommt.
Er war der Garant für bundesweite PR-Maßnahmen für ihre weiteren Transportpläne.
Sollte sie doch mitsamt ihrem Konvoi auf ihn warten.
Beim Aussteigen aus dem Taxi hatte er gegenüber der Einfahrt des Schlachthofes ein Café entdeckt. Er griff hinter sich, öffnete das Case, überlegte kurz welches Papier er nehmen sollte, entschied sich für den ZDF-Briefkopf statt für seinen privaten und schrieb: „Bin im Café Schien, warte seit 9 Uhr dreißig! Kammer. “ Den Zettel heftete er an die Eingangstüre des Verwaltungsgebäudes
Vom Café aus konnte er die Einfahrt zum Schlachthof im Auge behalten. Sicher ist sicher.
Erst beim Betreten des Cafés fiel ihm auf, mit welcher Selbstverständlichkeit er den Namen „Schien“ geschrieben hatte, ohne ihn bei seiner Ankunft heute morgen bewußt gelesen zu haben.
Am biedermeierlich wirkenden Mobiliar erkannte er es wieder.
Und auch der ovale Hallenbau, an dem das Café klebte wie ein Schwalbennest, war ihm nicht fremd. Dieser Bau war ihm schon einmal aufgefallen, weil er ihn an die schwangere Auster, die Berliner Kongresshalle erinnerte.
Kammer suchte sich einen Fensterplatz, ließ sich in plüschigem Kaffeeduft nieder und kramte in seinem Hirn.
Beklemmung beschlich ihn.
Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen, die Brillengläser beschlugen. Untrügliche Anzeichen für das Wiederaufsteigen peinlicher Situationen. Ein unangenehmes, verdrängtes Stück seiner Vergangenheit wollte ihn heimholen.
Hier um die Ecke musste irgendwo eine Bretterbude stehen. Hier hatte ihm jemand auf den Zahn gefühlt – im Hanauer Club Voltaire. Neunzehnhundertsiebenundsechzig.
Damals war er aus Frankfurt in die Provinz geflohen vor der Radikalisierung des akademischen Nachwuchsclubs der SPD. Er wollte seinen Studienabschluß nicht riskieren und auch nicht seine hoffnungsvollen Debuts beim hessischen Rundfunk, mit denen er sein Studium finanzierte. Für die weitere Arbeit im Funkhaus war politisches, ja sogar linkes Profil durchaus nützlich. Es durfte jedoch nicht zu viel sein, nicht zu links, nicht zu radikal. Er pendelte mit Presseausweis zwischen Lagebesprechungen im Polizeipräsidium und Vorstandssitzungen im Büro des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, zwischen ASTA-Sitzungen und achzehntem Kommissariat und war auf allen Seiten ein gefragter Gesprächspartner, der sich in den Strukturen auskannte, der Pläne, Strategie und Taktik, Gegenpläne, Gegenstrategie und Gegentaktik der jeweiligen politischen Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen konnte. Er geriet in den Verdacht, ein Spitzel zu sein, ein Verdacht, den die radikale Linke damals wie heute gegen viele Journalisten hegte. Kammer floh. Sein Ruf im Funkhaus hatte gelitten. Er bekam keine Insiderinformationen mehr. Er mied das Zentrum, wo man ihn kannte. Er wollte sich durch führendes Mitschwimmen am Rande wieder Vertrauensvorschuß verschaffen. Ohne Verhaftungen und Blessuren war das nur noch im Umland möglich. So kam er nach Hanau. So lernte er auch den süßlichen, laugenbrezelartigen Geruch der Kautschukbetriebe kennen, der ihm heute morgen fast den Atem verschlagen hatte.
Der Streik der Gummiarbeiter neunzehnhundertsiebenundsechzig. Gelegentlich hatte er zusammen mit Hanauer Jungsozialisten vor den Gummibetrieben Flugblätter verteilt, die zum Generalstreik gegen die Notstandsgesetze aufriefen. Kammer spielte den linksradikalen Agitator, lieferte sich heftige Wortgefechte mit dem Bezirksleiter der IG Chemie, den er als Arbeiterverräter beschimpfte, weil der ihn vor den Werkstoren einen studierten Provokatuer genannt hatte. Kammer wußte seinen Namen noch: Franz Fabius, der linke Gewerkschaftsfuktionär, war ihm bei seinen Recherchen über sozialdemokratische Industrie-Karrieren wiederbegegnet, als Besitzer eines mondänen Reitstalles in der Nähe von Hanau. Ende siebzig ging Fabius noch einmal durch die Schlagzeilen der Boulevardpresse: „Tragisches Ende eines reichen Roten“. Fabius hatte Selbstmord begangen.
Kammers agitatorischer Höhepunkt -kurz vor seiner „Enttarnung“ war die Begegnung mit Hanaus Oberbürgermeister Dröse, der den Polizeieinsatz zum Schutz der Streikbrecher vor dem Dunlop-Haupteingang persönlich leitete. Kammer hatte ihn über Megaphon mit „Guten Morgen Herr Oberbürgermeister Noske!“ begrüßt, „Einer muß ja wohl den Bluthund machen!“ , was ihm johlende Zustimmung seitens der Streikenden und der vor Schulbeginn am Werkstor versammelten Jungsozialisten einbrachte. Seine Rede vor dem Eintreffen des Oberbürgermeisters über Notverordnungspolitik und die Rolle des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten bei der Niederschlagung des Aufstandes in Berlin-Wedding 1929 war auf fruchtbaren Boden gefallen, obwohl er in der Hitze des Gefechts den Polizeipräsidenten Zörgiebel mit dem sozialdemokratischen Kriegsminister Noske verwechselt hatte.
Fruchtbar für ihn, für seinen Ruf als Linker, den er aufpolieren konnte –
bis Volker Lahner auftauchte.
In Kammers Innerstes schien ein Schimmer.
Der Namenszug dieses Cafés hatte eine der vergessenen Geheimtüren geöffnet, ein Fenster aufgestoßen.
Schillernde Gestalten zogen daran vorüber, die mit ihm nicht den gleichen aber einen ähnlichen Weg gegangen waren. Die Wesensverwandtschaft zwischen Kriminellen und Kriminalisten erleichtert die Aufklärung von Verbrechen. Er haßte diese Verwandten, die ihn so schnell durchschauten.
Leute wie Manfred Neuthal, vom Juso zum Bürgermeister, vom Bürgermeister zum Landrat, vom Landrat zum Immobilienhai.
Oder Holländer, der aufgestiegene Loklreporter. Wenn von denen bloß niemand mitfuhr!
Schemenhaft wie auf überbelichteten Fotographien sah Kammer die Menschen, die ihn aus Hanau verjagt hatten und einen davon ganz deutlich: Volker Lahner, der Trotzkist, ruhig und souverän, freundlich, liebenswürdig, erfahren und belesen wie ein wandelndes Geschichtsbuch aber hart und unnachgibig, wenn er den politischen Gegner witterte. Lahner hatte am Abend der „Noske-Begrüßung“ Kammer im Club Voltaire in die Mangel genommen, zunächst seine Rede über Noske vor den Streikposten gelobt ohne auf der Verwechslung herumzureiten, dann aber ruhig und messerscharf gefragt, warum er, Kammer, so schnell aus Frankfurt verschwunden sei. Kammer spürte die Schweißperlen auf seiner Stirn. Fluchtartig verließ er den Club, noch bevor Lahner den verdutzten Hanauer Linken Kammers Frankfurter Doppelspiel erklären konnte.
Und noch einer tauchte im grellen Licht der Erinnerung auf: eine dürre, schlacksige Gestalt mit eingezogenem Genick und immer zu kurzen langen Hosen: Willi Lang, kurz „Tally“ genannt, der Theoretiker der Hanauer Linken und heimlicher Chef des Club Voltaire. Daß Kammer sich an ihn erinnerte, lag weniger an Tallys Diskussionsbeiträgen als an dem Umstand, daß Tally ihm während einer durchsoffenen Nacht gestanden hatte, er wolle sein Studium abbrechen und Kulturjournalist werden.
Kammer bot sich ihm damals als Mentor an, weil er die Chance sah, über diesen Provinzhäuptling seine Rehabilitation im Lager der Linken schneller zu erreichen.
Und Tally glaubte an Kammers Sprüche von guten Beziehungen zum Intendanten des Hessischen Rundfunks und sah sich bereits in einem Studio in der Bertramstraße sitzen statt allabendlich in dieser Bretterbude an der Hanauer Nußallee oder im linken Stammlokal, dem Wilhelm zum Goldenen Herz. Daß Kammer zwischenzeitlich bei ihm in Hanau wohnte, machte die Sache noch hoffnungsvoller, war doch damit Tallys Wohnung zumindest ein provisorisches Studio Hanau des Hessischen Rundfunks geworden und er indirekter freier Mitarbeiter.
Kammer mußte wieder die Brille putzen.
Der Blick auf die Straße, die Unterführung und das Wohnsilo gegenüber beruhigte ihn.
Das war eine andere Stadt.
Das ist eine andere Zeit.
Fünfzehn Jahre lagen dazwischen.
Es hatte aufgehört zu regnen.
Leise Tanzmusik für ältere einsame Herzen, flüsternde Kaffeehauskonversation wiegten ihn auf trägen weichen Wellen, lullten ihn ein und deckten Nebel aus Tabakrauch und Sahnemokkatortenpralinen über sein fieberndes Gedächtnis. Die Bilder verblassten und lösten sich in die diesige Mittagssonne auf, die hinter den großen Scheiben des Cafès wohlige Wärme verbreitete. Fast Körperwärme. Kammer schien sich selbst aufzulösen.
Sein Kinn sank wie in Zeitlupe auf den orangefarbenen Schlips. Kammer schlief erschöpft ein. …..

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Willys
Aufwallungen
im
Öffentlichen Nahverkehr
Erzählung aus dem Prosa-Zyklus Grenzgänger
Umbruch für Lesungen beim Hanauer Bürgerfest im Pavillon der Hanauer Straßenbahn HSB , in der Stadtbücherei, im Hanauer Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten NLT zusammen mit dem Frankfurter Mundart-Blues-Liedermacher
zusammen mit dem Frankfurter Mundart-Blues-Liedermacher
Der schwarze Lodenmantel wölbte sich beim Einsteigen in den Bus
wie ein Segel im Wind.
Tally schaffte es eben noch, ihn einzuholen, bevor sich die Türe schloss.
Fast wäre er hängen geblieben.
Mit eingezogenem Genick, die linke Hand am breitkrempigen Hut,
in der rechten den Fahrtausweis, hangelte er sich am Fahrer vorbei zwischen den stehenden Fahrgästen hindurch zur Busmitte.
Nahverkehrsakrobatik.
In Bohemegarderobe bei fast dreißig Grad im Schatten.
Doch Hut und Loden mussten sein.
Tallys Statussymbole.
Längst nicht mehr notwendig,
aber zur zweiten Haut geworden.
Der Bus war berstend voll.
Freitag Nachmittag.
Berufsverkehr.
Alles, was nicht in endlosen Blechkarawanen ersticken wollte, quetschte sich in die Busse zum Westbahnhof, zum Freiheitsplatz, drängte zum Hauptbahnhof auf der Flucht ins Umland.
Feierabend.
Er bekam keinen Sitzplatz, mußte stehen.
Ungerecht, dachte er, die gehen ins Wochenende,
ich habe noch etliche Stunden vor mir.
Am Marktplatz würde ein Teil aussteigen,
Zwischenstop für eilige Einkäufe oder fürs Abschalten im Stehcafé.
Davon hatte er aber nichts.
Dort mußte auch er raus.
Die Fahrt ging im Schritttempo.
An jeder Haltestelle zwängten sich Pkws trotz des ununterbrochenen Gegenverkehrs am Bus vorbei nach vorne,
während Tally seinen Stehplatz gegen aufrückende Passagiere verteidigen mußte.
War es Standhaftigkeit, Beharrungsvermögen, war es die Gravitation?
Immer zog es ihn in die Mitte des Busses und hielt ihn dort,
wo er sich am sichersten fühlte.
Die Mitte bot Schutz vor den dauernd lauernden Gefahren.
Aber es war nicht nur die Angst eines crash-dummies,
dem von allen Seiten Aufprallangriffe drohten:
von links, von rechts von vorne von hinten.
Von Oben und Unten, das war nicht so wichtig,
wann stürzte schon mal ein Flugzeug auf die Stadt, wann schlugen Meteoroiden ein, wann gab es im Rhein-Main-Gebiet größere Erdbeben oder Sintfluten?
Es war die Anziehungskraft des Schoßes,
das Zentrum des weiblichen Körpers zog ihn mit magischen Kräften in die Mitte. Die Frau, der Bus, die Bach, der Brill. Auch die hessische Grammatik gab dem Bus nichts Feminines. Oder fahren in Hanau trotz dieser Geschlechtsregelung weibliche Busse ? Immerhin waren es Busse der Hanauer Straßenbahn AG und damit Tram-Ersatz. Die Tram. Und er reagierte instinktiv auf dieses nur oberflächlich vermännlichte Wesen
Psychologistischer Mist!
Es waren die frühen Straßenbahnerfahrungen aus den fünfziger Jahren,
als er mit seiner Mutter zwei, drei Mal im Jahr vom Frankfurter Ostbahnhof aus
zur Zeil zum Kaufhaus Schneider oder in den Zoo gefahren war,
mit der Tram.
Der Uniformierte mit der Hängekasse vor dem Bauch,
die auf Daumendruck schier endlos Groschen ausspuckte,
dieser Hoheitsträger hatte jedes Mal in mühsam angelerntem Hochdeutsch gerufen: „Bitte in die Mitte gehen!“ Diese Respektsperson, die mit einem Strippenzieher, einem Klingeln ein riesiges Monstrum in Bewegung setzen konnte. Alles musste ihr gehorchen!
Schaffner, Kontrolleur, Kassierer, ja sogar Zugführer, kein Militär-Zug-, kein D-Zug nur ein Straßenbahn-Zug aber immerhin ein Zug-Führer, eine Führer-Persönlichkeit:
not very big; but a leader!
Tally war sich nicht sicher. Möglicher Weise kam seine Sucht zur Mitte und das dazugehörige Zitat aus einem Lied von Weiß-Ferdl oder von Karl Valentin:
„Ein Wagen von der Linie Acht, weiß-blau fährt ratternd durch die Nacht…“
Das musste Weiß-Ferdl gewesen sein! Der gesprochene Refrain: „Bitte in die Mitte gehen..“
Die Luft im Bus war schwül und schweißgeschwängert.
Seine Körpergröße brachte ihm hier keinen Vorteil.
Er hatte zwar freie Sicht über die dichtgedrängten Köpfe,
aber der Mief war unter der Decke am dicksten.
Tally hielt sich über Kopf mit einer Hand an der hinteren Stange der Lüftungsklappe fest und versuchte mit der anderen, sie zu öffnen.
Die Klappe klemmte. Eine Klappe die klemmt statt zu klappen musste eigentlich Klemme heißen. Klemme aufklappen, nichts einklemmen, zuklappen, zuschnappen, einschnappen. Halt mal die Klappe, nein, er wollte die Klappe nicht halten, er wollte sie öffnen, was nicht klappte. Vielleicht war diese Klappe jetzt nur etwas eingeschnappt. Der Widerstand der Klappe – nicht von Pappe, dem Ritter viel die Klappe, dann kämpfte nur sein Knappe, saß im Rappen, Helles zappen, Bier verklappen, weg der Lappen, die Pappe im Eimer, Pappenheimer, Pappenkappen.
Papperlapapp.
Klappe!
Oh je, hatte er das jetzt laut gesagt?
Klappe! Die Zweite.
Er stemmte sich rückwärts dagegen.
Erfolglos.
Erst beim zweiten Versuch gab die Klappe ruckartig nach,
seine Hand stieß kurz ins Leere, er verlor sein Gleichgewicht
und konnte sich nur durch einen Ausfallschritt nach hinten auf den Beinen halten,
wobei er nicht auf seinem sondern einem fremden Fuß zum Stehen kam.
Die schwarzverschleierte Frau hinter ihm autschte kurz auf.
Tally lief rot an und stammelte eine knappe Entschuldigung.
Die Frau verzieh ihm lautlos mit mild lächelndem Augenaufschlag
und gab ihm zu verstehen, daß der kühlende Luftstrom aus der Klappe
sie für seinen Fehltritt entschädigte.
Zwei, drei Mitfahrer musterten den schwarzen Filzhut und den Lodenmantel
mit verständnislosem Kopfschütteln.
Einer kommentierte halblaut:
„Wonn der kaan Hitzschlach krieht.“
Tally fing trotz des Fahrtwindes an zu schwitzen.
Er ignorierte die Blicke und schob seine Hutkrempe tiefer in die Stirn.
Schweigen im Bus.
Die Körper um ihn herum schwankten
im unregelmäßigen Takt der Kurven und Schlaglöcher,
der Beschleunigungs- und Bremsmanöver.
Normalerweise beruhigte ihn das, versetzte ihn in Trance
mit kaum spürbarem Pulsschlag,
in die Halbschlafatmosphäre morgendlicher Pendlerzüge.
Je nach Tageszeit und Leistungskurve, Alter oder Adrenalinspiegel
konnte man dabei einnicken oder im Takt mit den Füßen wippen,
mit den Fingern schnipsen und im Stehen kaum merklich die Hüften schwingen.
Im Bus klappte das nur selten,
und wenn, dann kurz und schlecht.
Beim Busfahren war der Blues jedenfalls nicht erfunden worden.
Da gab es keine sich endlos wiederholenden immergleichen Taktfiguren.
Im Zug war das anders.
Train und Blues gehörten zusammen.
Früher als Fahrschüler hatte er oft so seine Endstationen verschlafen oder in den Zwischenabteilen endlos die neuesten Hits gegrölt, unterbrochen nur von Haltepunkten und Dorfbahnhöfen, Einsteigern und Aussteigern.
Mit Onkel Werres‘ Schlagerbörse aus Frankfurt war er groß geworden.
Das Rattern der Räder war Schlaflied und Playback.
Die Zwischenabteile waren Tallys Proberäume,
viel besser als Duschkabinen und Badewannen.
Auch die öffentlichen Badeanstalten waren trotz ihrer ausgezeichneten Akustik nicht besser geeignet, weil er dort in schönster Regelmäßigkeit von hirn- und beinamputierten Rentnern erwürgt wurde: „Hör sofott uff mit dere Neeschermussikk, sunscht haach isch derr die Krigge um die Ohrn.“
Das war noch einigermaßen zu ertragen, dagegen ließ eine hochdeutsch geschmetterte Aufforderung deutsche Lieder zu singen Tally gleich doppelt verstummen, äußerlich und innerlich. Solchen Aufforderungen pflegten bei Nichtbefolgung außerordentlich standrechtliche Erschießungen zu folgen.
Alptraumhaft bedrohlich und gleichzeitig bis zur kalten Gänsehaut faszinierend war es, wenn die Bereitschaftspolizei in halber Kompaniestärke zum Schwimmen ins Heinrich-Fischerbad einrückte. Da wurde Tally winzig klein, da platzten die stumpfen Kacheln ob des röhrenden Jungmannengesanges von den Duschwänden und begruben ihn unter sich.
Doch es waren nicht nur diese alten Blockwartsseelen, bei denen man nie wußte, wann sie die Gemeinschaftsduschen von Wasser auf Gas umstellen würden, es war nicht nur das Grölen der Marschkolonnen, das Knallen der Stiefel auf dem Asphalt, was ihn verstummen ließ. Auch nicht die Schiffsschraubenähnlichen Bewegungen rasender Arme und Beine, wenn eine Hundertschaft braunknackärschiger oder weißarschschwabbelnder GIs in Unterhosen versuchte das Schwimmen zu lernen und ihn im Wasser zu zerstückeln drohte.
Es war noch eine andere Angst, die ihn zum Schweigen brachte, und die war schon da, bevor die kaltduschende Manneszucht ihn im Hallenbad erwischte.
Zwischen sinkendem Knabensopran, Stimmbruch und erstem Oberlippenflaum traute er sich nicht, seine Lieblingssongs nachzusingen, wenn andere zuhörten.
Dazu mußte er im zugigen Dämmerlicht zwischen klappenden Toilettentüren und Waschräumen eines Zuges alleine sein.
Hier konnte er unbeobachtet der Körpersprache seiner Idole nachspüren, Sprünge und Tanzfiguren ausprobieren, ohne daß ihn Schulfreunde auslachten, weil diese Imitationsversuche wegen seiner Schlaksigkeit eher wie misslungene Karikaturen wirkten.
Hier brauchte er nicht die abschätzigen Blicke der heimlich nahegewünschten Mädchengesichter fürchten,
Blicke, denen er es später einmal zeigen wollte.
Am liebsten sang Tally bei Stromausfall in den Morgenstunden oder auf Tunnelstrecken. Da träumte er sich auf die großen Bühnen neben Elvis, Blue Diamonds, Animals und Ringo Star. In den Ami-Clubs hatte er sie zum Greifen nahe gehabt, wenn er schmachtgelockt hinter den Vorhängen in den Fensternischen versteckt den Tillman Brothers nachgrölte und nur die Luft anhielt, um der MP und Hanaus Polizeichef Holbein nicht in die Hände zu fallen.
Holzbein, die Rittmeisterhosen stramm um die Prothese geschnallt machte immer höchst persönlich Jagd auf Halbstarke im Lamboy-Viertel rings um die Kasernen, Regelmäßig unregelmäßig donnerte der auf seiner Dienst-BMW -oft im Stand, wie bei einer Parade- mit gezogener Pistole durch die Lamboystraße. Garry Cooper und John Wayne konnten gegen ihn einpacken.
Er war das Gesetz.
Holbein hatte als Rittmeister vor und während des Krieges genügend Erfahrung im Umgang mit willenlosen Befehlsempfängern und Untermenschen gesammelt.
Zurück aus Russland wurde der drahtige Bulle trotz Amputation an der Heimatfront dringend gebraucht zum Kampf gegen Kriminelle und Kommunisten, was für ihn nicht das Gleiche war.
Für ihn waren die Roten schlimmer.
Sheriff Holzbein war Law and Order und über ihm
– bis weilen auch nur neben ihm –
standen nur noch die Präsidenten der Vereinigten Staaten, die er der Reihe nach duzte, wenn sie gelegentlich übern Teich kamen und in West-Germany und Hanau vorbeischauten.
Dwight, JFK, Nixon, LBJ, Dicky George, sie alle konnten sich auf Holzbein verlassen.
Er hatte alle und alles im Griff.
Holzbein sah alles, fand jeden Verbrecher und wen er dafür hielt, Juden, Zwangsarbeiter, DP’s, Zigeuner.
Nur eines hatte Holzbein übersehen, die Fensternischen im Skyline,
und einen hatte er nie gefunden, Tally blieb im Dunkeln unbehelligt.
Sein Stehplatz auf der Fensterbank, umhüllt von Lärm und nikotingebräunten Vorhängen barg ihn wie das Dämmerlicht im Zug, das Kreischen der Bremsen, das Hämmern der Räder auf den Schienen, hier hörte niemand sein Heulen und Singen.
Die Tillmann-Brothers waren laut und schrill genug.
Die Zwischenabteile boten Tally auch in anderer Hinsicht geliebte Stehplätze, wenn es morgens im Gerangel zwischen kaufmännischen Angestellten, Verkäuferinnen und Mitschülerinnen angenehm eng wurde.
Zielschieben nannte Tally das scheinbare sich Treibenlassen zwischen den noch schläfrigen Leibern.
Da streifte er Schenkel und Backen, Brüste und Arme, streichelte mit Mund und Nase ganz absichtslos Pferdeschwänze, Zöpfe und verrutschte Hochfrisuren.
Mit geschlossenen Augen saugte er Duftmischungen
aus noch warmem Nachtschweiß, Haarspray und Parfüm
in sich auf.
Tally wußte genau, wohin er sich treiben ließ.
Er war groß und verlor so selten den Überblick.
Zielschieben.
Das war damals schon fast Tanzstundenfieber.
Die etwas früh entwickelten Engelsbrüste der achten Klasse konnte er nur im Zwischenabteil erreichen. An die der neunten, zehnten oder gar der Elften wagte er kaum zu denken.
Draußen waren sie alle für ihn unerreichbar.
Tally hatte aus seiner langen schlaksigen Not eine Tugend gemacht.
Die allseits begehrten Brüste lagen, nein sie standen unter seinem Niveau.
Zunächst nur – zu seinem Leidwesen- unabänderlich topographisch. Dann aber auch seelisch und geistig.
Denn Tally pflegte als Ausgleich für sein wenig glänzendes Äußeres seine inneren Werte mit Philosophie, Politik, Religion und Sozialkunde.
Er fühlte sich dabei zwar wie jemand, der seinen Durst mit Knäckebrot stillte, doch er sah für sich keinen anderen Ausweg.
Nur im Dunkel der Tunnelstrecken, im morgendlichen Gedrängel der Zwischenabteile und Gänge mit ihrer übernächtigtfunzelig flackernden Notbeleuchtung konnte er die spartanische Maske, sein durchgeistigtes Korsett fallen lassen und sich seinen animalischen Instinkten und Bedürfnissen hingeben. Treiben – treiben lassen, sich treiben lassen – treiben, es treiben, wenn es satt klatschte und schmatzte.
Verrucht und spannend.
Der Kragen seines Seidenhemdes spannte am Hals wie die Vorhaut um die schwellende Eichel.
Hastig knöpfte er auf, was ihn beengte und wunderte sich dass er zum Hemd und nicht zur Hose griff.
Tally blickte unter seiner Hutkrempe in die Runde, suchte nach Bildern, nach den umflaumten Gesichtern und den kleinen festen Brüsten, die die Last der Kurven und Schlaglöcher, das ruckende Wechseln vom Gas zum Bremspedal zur Lust gemacht hätten.
Wie früher im Zug
und nur da.
Draußen wollte keine zu ihm auf den Soziussitz.
Er hatte kein Moped und die Querstange seines Fahrrades brachte blaue statt Knutschflecken.
Ihm blieb das Zwischenabteil für zwischenmenschliche, zwischengeschlechtliche Beziehungen.
Hier hatte er, wenn auch viel später als die anderen in seiner Klasse, den ersten Übergang vom Nachhintenstolpern zum weichen Zurückweichen erlebt, den ersten Gegendruck im Dunkeln beim plötzlichen Wiederanfahren des Zuges, die ersten verstehenden Augenblicke, wenn das Licht wieder aufflackerte und er sich mit schlecht versteckter stolzgebeulter Hose und schwellender Brust auf den kühn-frühen und kühlenden Absprung aus dem noch fahrenden Zug vorbereitete, um vor der ungewissen Fortsetzung, seinem drohenden Versagen oder der befürchteten Abweisung zu fliehen.
Tally traute sich nur langsam weiter.
Seltene und beängstigende Lustgefühle, wenn aus den Petticoats kurz vor dem Absprung Pettingcoats wurden, Hände und Lippen nicht nur feucht vor Angstschweiß, das Herz in die und sein Schwanz aus der Hose rutschte, die Knie weich und ergriffene Brüste und Pimmel hart wurden.
Was sich da absichtslos und absichtsvoll rieb, erzeugte unerträgliche Spannung, drängte nach Entladung. Ein Funke hätte genügt, eine weitere Berührung. Doch meist ging das Licht wieder an, war der Tunnel zu Ende, tauchte ein Schaffner auf oder der Zug fuhr mit quietschenden Bremsen im Hauptbahnhof ein.
Schwanz oder Pimmel, Fotze oder Möse, Titten oder Brüste, sein Wortschatz für Unbeschreibliches, Unentdecktes, wie die Zielgebiete seiner frühen Forschungsreisen war begrenzt wie das Weltbild deutscher Bauern im frühen Mittelalter. Seine Gefühls- und Begriffswelt glich der Erdenscheibe vatikanischer Weltkarten, umzingelt von einem undurchdringlichen Ring weißer Flecken. Am Rand drohte der Absturz in unendliche Schrecken, in höllisch-barbarische Pein.
Ich bin klein, mein Herz ist rein.
Von wegen!
Groß war er und das mit der Reinheit beschränkte sich in der Regel auf seine Nyltest-Oberhemden, die ihn zum Waschzwang zwangen, weil die unvermeidliche Synthese von Nylon und Schweiß sofort einen Geruchscoctail aus Katzenpisse und Buttersäure produzierte und seine Nase auf die Spur zu den abgelegten Strumpfhosen seiner älteren Schwester heftete.
Die stanken genau so.
Besonders in der Mitte.
Er hatte Schwierigkeiten mit all diesen erbsündig glitschigen Dingen unter der Gürtellinie, am Rande der Wildnis, vor dem Abgrund zur Hölle, auf denen man leicht ausrutschte und auf die schiefe Bahn geraten konnte
Bleib weg vom Rande und vermehre dich ehelich.
Tally brauchte lange, um sich in diesen Dschungel vorzuwagen, heimlich zunächst, ängstlich, verklemmt, voller Schuld- und Schamgefühle. Doch der Ruf des Dschungels hatte ihn erreicht, gelockt und gefangen. Ganz anders als Tarzan seine immer frischgeduschte und geföhnte Jane.
Er begann zu befühlen und zu begreifen und zu benennen. Die vorfindlichen Namen machten ihm die Wortwahl oft zur Qual bis zum Stottern.
Aber das war noch vor der Zeit der Züge und zugiger Zwischenabteile.
Oder doch nicht?
Wenn Tally ehrlich mit sich selbst war, was ab und zu
passierte, mußte er zugeben, daß er dieses beklemmende Stottern,
diese stotternde Verklemmtheit angesichts nackter Tatsachen bis
heute mit sich herumschleppte. Trotz seiner 68er Wilhelm Reich-Schulungen und trotz der sogenannten sexuellen Revolution.
Die richtigen Worte.
Schwanz war ihm als Pennäler zu brutal und zudem anatomisch falsch – diese Erkenntnis hatte er aus
dem Biologieunterricht .
Er konnte kaum seine eigenen Geschlechtsorgane begreifen,
geschweige denn die weiblichen.
Penis war ihm zu wissenschaftlich trocken, obwohl das „nis“
nach dem „Pe“ phonetisch schon nass genug war.
Aber es ließ die ergreifend himmlisch-höllischen Gefühle außen
vor.
Er entschied sich für das eher kindlich klingende Wörtchen
Pimmel, das den witzigen kleinen Kerl, mit dem er sich langsam anfreundete, in jedem Zustand und jeder
Lage, sein aufmüpfendes unbeherrschtes Verhalten angemessen beschrieb
Pimmel, das klang wie ein junger, ausgelassener Hund, den man
gewähren lassen mußte, der sich an jedes Bein heranmachte, wenn
es ihm gerade danach war.
Sich mit den weiblichen Weichteilen zu befassen fiel Tally um
einiges schwerer.
Sie zu bezeichnen, ohne sie gesehen zu haben war ihm unmöglich, sie
zu begreifen, ohne sie zu fühlen ebenfalls.
Fotze klang ihm zu tierisch, verurteilend, abwertend. Es klang
zwar feucht, so wie er sie zum ersten Mal ertastet hatte, aber
eher nach Rotze und damit verband er Ekel, obwohl er sich
durchaus gerne ob des salzigen Geschmacks in unbeobachteten
Momenten in der Nase bohrte, ausgiebig und mit Lust. Auch heute noch.
Vagina und Klitoris klangen wie eine griechisch-römische
Freistil-Tragödie aber auch -trotz der feuchtklingenden Klitoris
gerade so wie Penis wissenschaftlich trocken und Tabu-belagert.
Möse fand er nach anfänglicher Abwehr mit der Zeit am passendsten:
gemütlich warm, feucht und nicht zu hart, bisweilen saftig wie Ananas in der Südsee. Muschi war zu Infantil, so konnte man allenfalls eine Katze nennen. Bei Muschel wurde ihm schlecht, so wie ihm bei seinem ersten Versuch Paella zu essen speiübel geworden war.
Er brauchte Miesmuscheln nur zu sehen, prompt überkam ihn heftigster Brechreiz. Austern kannte er nur von den Perlmuttknöpfen an der Bettwäsche, der Perlenkette seiner Mutter und vom Biologieunterricht: ein Film über Austernfischer, Perlentaucher und Austerngerichte in einem Schlemmerlokal. Er hatte sich in sein Hirn eingebrannt, so tief wie später die surrealistischen Filme von Salvatore Dali, wo Ameisen aus offenen Handinnenflächen hervorquollen. Der Gedanke, Austern essen zu müssen, ließ ihn würgen und Bilder hochkommen, die ihn abstießen und gleichzeitig faszinierten: Kühe, die ihre Nachgeburt schlürften, Hunde die sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile berochen und beschleckten. Ein Wechselbad von Ekel und aufschimmernder animalischer Lust.
Tally war in Wallung geraten. Er spürte, daß er rot wurde. Die Menschen um ihn herum mussten seine Gedanken mithören.
Die innerliche Hitze ließ den Schweiß auf seiner Stirn im Luftstrom aus der Klappe eiskalt werden.
Aus der Traum.
Der Bus war kein Zug und Tally stand unter Druck.
Kein Dösen, kein Rock, kein Blues und keine Brüste – zumindest keine erreichbaren.
Die Zeit drängte, um fünf begann die Redaktionskonferenz und Little kannte kein Pardon, wenn der Haufen nicht pünktlich versammelt war.
Auf der Phillippsruher Allee an der Kinzigbrücke war alles vorbei.
Der Bus steckte im Stau.
Willi Lang verlor seine antrainierte Souveränität und wurde nervös.
Er nestelte am Revers seines Edellodens und machte sich mit dem Gedanken vertraut, entweder zu Fuß verspätet und abgehetzt die Redaktion zu erreichen oder aber noch verspäteter mit dem Bus, dafür weniger derangiert .
Eigentlich hatte er gar keinen Anlass zur Hektik.
Als Kulturredakteur genoss er eine gute Portion Narrenfreiheit und selbst von Little bekam er sein Dauerabonnement auf das akademische Viertel zugestanden.
Trotzdem.
Tally hasste es, auch nur andeutungsweise auf Gnade angewiesen zu sein.
Besonders auf die Gnade seines Chefredakteurs.
Dieter Kleine, der kurze quirlige Allroundentertainer, der peitschenschwingende Zirkusdirektor, hatte ihn lange genug spüren lassen, daß er eigentlich nicht dazugehörte.
Erst als die Hassliebe zu seinem Brötchengeber in eine Vernunftehe mit gewachsener Angleichung zwischen Herr und Hund, zwischen Dompteur und Tiger mutiert war, wurde er in die kleinbürgerliche Redaktionsrunde des Hanauer Anzeiger aufgenommen.
Tally als Tiger, als ‚tiger‘
lächerlich.
Seine Elvis-Eskapaden wurden in der Hanauer Rockerszene nur belächelt. Er bekam nicht einmal eine in die Fresse.
Aber etwas war schon dran – am Tiger.
Etwas war hängen geblieben.
Er konnte nach wie vor die Krallen und die Reißzähne zeigen.
Für den Anzeiger war seine Mitarbeit anfänglich ein gewagtes Spiel gewesen.
Tally ging Elvis‘ Tigersong durch den Kopf.
Der Tiger als Symbol für nicht zu bändigende Rebellen.
Der Tiger als Sieger.
Touch me, Tiger.
Gerne wäre er einer gewesen, auch bei den Frauen.
Aber war nix,
weder körperlich noch politisch.
Little hatte ihn wie Esso in den Tank gepackt.
Er verlieh dem Feuilleton dieses Provinzblattes beißenden Glanz, der jedoch jederzeit abzustumpfen drohte.
Das Bild des unbeugsamen Dschungelkönigs schrumpfte in den deutschen Tiger-Adaptionen auf Kuschel-Steiftier-Format zusammen – mit den mühsam einstudierten eckigen Rock n‘ Roll-Hüftleidenschwüngen eines Peter Kraus.
Grässlich.
Tally beschlich das Gefühl welkender Petersilie und schrumpelnder Gelberübenscheiben auf einem in Essig ertrunkenen deutschen Kopfsalattellerchen.
Der Ex-Rebell als Schnitzelbeilage.
Für einen gestandenen und lokal profilierten Altachtundsechziger, wie ihn, war der Aufstieg zum journalistischen Landadel ein zuweilen sehr schmerzhafter Prozess.
Schrumpelnde Gelberüben – „Geele Riewe“ nannte sich der Verein zur Pflege des Hanauer Brauchtums.
Jetzt durfte und mußte auch er mit-„tümeln“.
Das tat weh.
Der Mutationsversuch vom Elvis-Tiger zum Tucholsky-Panther war ihm nicht geglückt.
Mehr Pantoffel als Panther.
Er war auf der Strecke geblieben. Und bekam es zu spüren.
Gerade hier auf der Phillipsruher Allee, auf der Provinz-Kulturmeile
zwischen Kulturbazar, Rheinhardskirche, dem Museum im Schloss Phillippsruh, dem Olof-Palme-Haus, der Pumpstation, dem Jazz-Keller und der Volkshochschule war er bei seinen Kritikvisiten jahrelang Spießruten gelaufen.
Er mußte sich verspotten lassen.
Für ihn hatten nette Menschen aus der Scene den „Mustang Sally“ in „Bastard Tally“ umgetextet. Er kannte die anonymen Texter, die sich in Biographie und Stallgeruch nur um Nuancen von ihm unterschieden. Doch diese fünften, sechsten, siebten Stellen hinter dem Komma hatten entschieden.
Keine Kulturinitiative, keine politische Gruppe lud ihn ein.
Er wurde gemieden,
so als dünstete er den Geruch des Verräters aus.
Er konnte sich lange Zeit selber nicht riechen,
sah sich im Spiegel nicht nur älter und glatzköpfiger sondern auch spießiger werden.
Mittlerweile stand er dazu.
Die anderen hatten gut reden.
Die hatten zum Teil viel früher als er ihre Jobs im öffentlichen Dienst, in der Kulturverwaltung, in der halbwegs etablierten Kulturszene, in den Schulen, in der Gewerkschaft als Teamer, als Psychotherapeuten, als Computerfreaks.
Während er noch eine Existenz als freischwebender Linker fristen mußte, mit Arbeitslosen- und Sozialhilfe, hatten die sich bereits in die Nischen des sozialdemokratischen Kultursumpfes verzogen, und sich dort zum Teil mit Pensionsansprüchen eingerichtet und abgesichert. Oder erklommen, nachdem sie den Anschluss an den rosaroten Eilzug verpasst hatten, den nächsten Bummelzug, der mit grünen Waggons und vorläufig durchgehend zweiter Klasse nach Wartezeit und vielen Zwischenstopps letztlich den gleichen Zielbahnhof ansteuerte.
Mit einem Anflug von Selbstironie nannte er diese Zeit sein Diplomstudium für angewandte Sozialwissenschaften im Bermudadreieck zwischen Arbeitsamt, Krankenkasse und Sozialamt.
Da kannte er sich aus wie kaum ein anderer.
Erst nach seinem steinig-steilen Aufstieg zum lokalen Kulturpapst mit Sitz in diversen Jurys hatten sich die Wogen auf dem Main geglättet.
Sein gesenkter Daumen, seine Kritiken entschieden jetzt über regionale Künstlerkarrieren.
Willi Lang genoss es, auf diese Weise späte Rache nehmen zu können.
Und viele Rütlischwüre einstiger Streetfighter erwiesen sich in den Warteschlangen vor den Kulturpreisrichtern denn auch als Seifen- oder Kaugummiblasen.
War ja alles nicht so ernst gemeint.
Nur wenige waren den Verlockungen öffentlicher Vereinnahmung nicht erlegen, wurstelten in unabhängiger Bedeutungslosigkeit vor sich hin, wurden totgeschwiegen.
Auch sie traf sein Bannstrahl.
Dass ein Provinz-Kulturpreis so gut wie eine Beerdigung erste Klasse war, beruhigte ihn doppelt.
So bekamen alle ihr Fett und der wirklichen Kunst war auch gedient:
Nicht umsonst hieß es ‚das Brot der frühen Jahre‘ und nicht die Torte. Sattheit schadet der Kultur.
Manchmal beneidete Tally diese Handvoll übriggebliebener Hungerkünstler um ihre kohlhaas’sche Standhaftigkeit.
Das Stehen im Bus ging ihm langsam auf die Bandscheiben.
An der nächsten Station könnte er aussteigen. Zu Fuß zur Redaktion waren es höchstens noch zwanzig Minuten.
Ein plötzlich einsetzender orkanartiger Gewittersturm nahm ihm die Entscheidung ab.
Von wegen geglättete Wogen.
Sturmböen peitschten den Main die Uferböschung hoch.
Der Bus schwankte.
Die Wellen klatschten meterhoch gegen die Brücke über der Kinzigmündung.
Das Kloakenwasser spritzte bis an die Scheiben.
Tally ging automatisch in Deckung.
Als er sich wieder aufrichtete, fiel ihm der Dialog zwischen zwei deutschen Putzfrauen ein, den er vor Jahren einmal nach einem Besuch im Skyline-Club an der Francois-Kaserne in Klein-Texas belauscht hatte.
Der fiel ihm immer ein, wenn er sich bei plötzlich einsetzendem starken Regen gerade noch in den Bus retten konnte.
Die Frauen kamen damals vor einem aufziehenden Gewitter zur Bushaltestelle an der Chemnitzerstraße, wo er auf den Spätbus wartete.
Die kleinere fragte die große:
„Take we de Bus oder go we bei feet?“ „Glei werds schitte, we take de Bus.“
Das war Hanau wie es leibt und lebt, in diesem deutsch-amerikanischen Gemisch fühlte er sich zu Hause wie alte Frankfurter zwischen Chaiselongue und Kanapee, Trottoir und Portemonnaie, Plumeau und Fissemantente.
Das Portemonnaie war seit über Hundert Jahren so urdeutsch wie die Toilette, sofern man eine hatte.
Selbst hartgesottene Franzosenhasser gingen mitten in beiden Weltkriegen gegen die alten Erbfeinde nicht gern auf den Abort.
Für das Scheißhaus gab es kein geeignetes hochdeutsches Wort.
Bezeichnendes Indiz für den Entwicklungsgrad teutonischer Kultur.
Die jüngeren Sprachimporte hatten es schwerer:
Pizza und Spaghetti hatten immer noch den Beigeschmack vom Messerstecher, den Döner Khebap übertönte der kameltreibende Kümmeltürke.
Mit dem Amerikanischen war das ein eigenes Ding:
Tally, sein Spitzname ging ihm über die Lippen, wie den vorigen Generationen Jean und Janette.
Vieles ging für viele ohne Zögern als Muttersprache durch, was aus dem Amerikanischen entlehnt war.
Und dann gab es doch Sprachgrenzen.
Zwischen Elvis und James Brown, Zwischen Roger Wittacker und Otis Redding, John Mayall und Jimmy Hendrix.
Trotz der vierzig Jahre in denen Kaugummi und Coca Cola alles eingeebnet hatten, blieb eine Frontlinie stehen, zwischen weißem und schwarzem Amerikanisch.
Das weiße zog man sich gedankenlos rein, der Akzent verschob sich etwas und alles war okey.
Wer aber die Frontlinie passierte, der roch nach Underunderdog, der rangierte noch weit unter der fuselfahnigen Kioskfraktion der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger.
„Briketts“ nannten die Hanauer die schwarzen GI’s, besonders im Kasernen-Viertel Lamboy.
Und was die Wertschätzung dieses Stadtteils für Schwarze betraf, so hieß der nicht umsonst „Klein-Texas“.
Wer sich dort als Frau mit „Briketts“ einließ,
war eine Amischlampe.
Wer einen Weißen erwischte,
war keine.
Da hielt noch der letzte Süffel die Schnapsnase und die Six-pack-Fahne hoch.
Und Amischlampe war fast so schlimm wie Judenschlampe.
Mit dem entscheidenden Unterschied, daß die Amischlampen sich mit den hassgeliebten Siegern eingelassen hatten und nicht mit den noch mehr gehassten Verlierern des tausendjährigen Reiches.
Sieger-Liäsonen brachten Nescafé und Schokolade, Miete und Untermiete, Carepakete und PX-Trips, Lucky Strike und Marlboro steuerfrei, Taxikunden und Tupperware und damit endlich die reuelose Anlehnung an die Sieger,
die sunny side of the Lamboystreet,
Rock n‘ Roll mit Kentucky fried chicken (die freilich etwas später),
ersten Jazz und mit einiger Verzögerung die ersten Joints.
Rock’n Roll und Chicken waren weiß wie Hühnerbrust, Jazz, Blues und Black Beat waren schwarz wie Eierkohlen (schwarz wie Koks konnte man im Lamboy nicht sagen).
Und „Briketts“ blieben „Briketts“.
Trotz PX und sunny Ronney-Chesterfield
Willi Lang hatte im Laufe der letzten zehn Jahre die Amerikanismen bewusst in seinen feuilletonistischen Wortschatz aufgenommen.
Bewusst und mit kultur- und sprachsoziologischen Theorien untermauert.
Die Amerikanismen waren seiner Meinung nach gewachsene Bestandteile der kulturellen Identität dieser Stadt, die mit fast dreißigtausend amerikanischer Soldaten und ihren Angehörigen zu einem Viertel amerikanisch war und das seit fast vierzig Jahren.
Besonders um die Kasernen herum in den Stadtteilen Lamboy-Tümpelgarten, in Wolfgang und Großauheim gab es jede Menge Besatzungskinder. „Mixed Pickels“.
Die Hälfte der Bevölkerung hatte solchermaßen zustande gekommene Verwandtschaft in den Staaten.
Zu Tausenden waren sie in der Nachkriegshungerzeit in die USA ausgewandert.
Eigenartige Wiederholungstaten, dachte Tally.
In fast gleichmäßigen Abständen von 50 und hundert Jahren.
Halbe Dörfer des Hanauer Umlandes verschwanden um 1780 als verkauftes Kanonenfutter in der britischen Kolonialarmee und blieben drüben, tot oder lebendig. Fünfzig Jahre später trieb der Hunger ganze Regionen über den Teich, Kriminelle und Kriminalisierte, gefolgt von Deserteuren und Demokraten, republikanischen Linken, gescheiterten Revolutionären.
Und hundert Jahre später.
Wieder Hungernde, wieder Kriminelle, und diesmal nicht wie kaum zehn Jahre zuvor zur Emigration gezwungene Naziopfer sondern abgedankte Herrenmenschen, Kriegsverbrecher, stramme Rechte, mit Blut und geraubtem Gut und Boden behaftete.
Welch ein Gebräu, das dort drüben auf ebenfalls geraubtem Land die Grundsuppe der Mickey-Mouse- und McDonald-Kultur bildete.
Tally erlag widerstrebend der Faszination dieser offenbaren Auswüchse und Geschwüre entwurzelter europäischer Desperados und Deportierter,
Drückeberger und Draufgänger.
Wie eine Springflut überschwemmte diese Suppe jetzt Europa,
das sie einst ausgeschüttet hatte mit dem Marschbefehl:
Macht euch die Erde untertan
- egal ob rot, ob gelb, ob braun oder schwarz.
Jetzt kam das Echo zurück.
Bereinigt von allen regionalen, religiösen, nationalen Schnörkeln, Zwischentönen, ideologischen Verzierungen.
Der gute alte Weihnachtsmann zum Santa Claus verballhornt ritt auf einer zum Rosinenbomber getunten Cocacolaflasche über frierende verschneite Kleinstädte.
Die Macht der Liebe kam wieder als die Macht des Dollars und traf gewaltig ins innerlichste deutsche Mark.
In die verinnerlichte Deutsche Mark.
Die Freude, schöner Götterbote echote höhnisch Lucky Strike in God we trust der Dollarnote. Amerikanisch verschnitten und millionenfach Rank-Xerox-kopiert schlug die deutsche Romantik auf ihren Ursprung ein.
Beethoven wird unvollendet eingespeist in Fish und Chips, Wagner kehrt tiefgefroren als Pizza in deutsche Kühltruhen zurück.
Waren schon Phillipsruh und Wilhelmsbad verschnörkelt verpackter Machtrausch, so wurden sie jetzt mit Neuschwanstein zusammen zur dekorierten Dekoration romantischer Verschleierung.
Kulisse zur Kulisse der Kulisse.
Nimm zwei im Doppelpack zum Sonderpreis in Nostalgieversion mit Quarztriebwerk.
Selbst durch die sechste Verpackungslage mit Schleifen und Zertifikaten grinste der Zweck unverhüllt das Opfer an.
The Goldsmithhouse is so fantastic romantic.
Es gab Hunderte von Gründen, den Einfluss des Amerikanischen auf die Sprache und die Kultur der Stadt, der gesamten Region zu bejahen.
Für Tally allerdings galten zumindest gleichgewichtig noch andere Gründe:
er vollzog mit seiner erst un- und dann bewussten Sprachwende eine Absetzbewegung gegen seine Vergangenheit, gegen alte Freunde und ehemalige Mitkämpfer vom linken Flügel, mit denen er gemeinsam gegen den politisch-ökonomisch-kulturellen Yankee-Imperialismus gestritten hatte.
Keine zehn Jahre war das her.
Tallys Sprachwechsel vollzog sich kaum bemerkbar.
Die von der amerikanischen Anti-Vietnamkriegsbewegung entlehnten Vokabeln der Antiautoritären Revolte ermöglichten ein leises Umschwenken:
Sit-ins, Teach-ins, Happenings, Peace now, Black-Power, Soulbrother…..
„Dont bother the joint my friend… “
Wie oft hatte sich der Grass-Qualm, Piece for Peace, im Hinterzimmer des Gasthauses „Zum Goldenen Herz“ oder im Club Voltaire mit gut deutschem Bierdunst vermischt.
während nebenan im Hinterzimmer die wackeren Spartacisten mit „C“ die Weltrevolution planten.
Good times…
Wenn sein Freund Schwinn alias Schwamm sich mit Binding vom Fass vollsaugte und zur Polizeistunde die Internationale zum Besten gab, mit geballter Faust den ins befreite Gebiet eindringenden Hipos sein entschlossenes „We shall overcome“ entgegenlallte.
Very good times..
Unübertrefflich Wilhelms Heldentenorwirtsstimme, die wechselweise „Umsatz! Umsatz!“ oder unvergessliche Marschlieder aus seiner freibierumspülten SA-Sturm- und Drangzeit durch die Wirtschaft schmetterte.
Wenn Wilhelm schunkelnd und schenkelklatschend bei der Sperrstunde Widerstand gegen die Staatsgewalt leistete, röhrte er meist „Keiner, ja keiner schiebt uns weg.“ im Viervierteltakt, dann kochte der Saal. Und die öffentlichen Hände waren verunsichert ob des Notenwechsels.
Auf den amerikanischen Text wollte er sich nicht einlassen.
„Das ist die Sprache der Besatzer!“
Den Vorschlag, das „Goldene Herz“ in „A Heart of Gold“ umzubenennen, lehnte Wilhelm aus gleichen Gründen kategorisch ab.
Dabei hätte das vielleicht viel mehr „Umsatz“ gebracht.
Good times… Best times!
Selbst die strammsten Protest-Songs , musikalisch und literarisch so wertvoll wie männergesangsgepflegtes deutsches Volksliedgut, klangen auf amerikanisch noch erträglicher als auf deutsch, wenn sie von stanilismusverdächtigen Schreibern wie Stütz, Wader, Süverkrüp und Co. in gewerkschaftlich abgesegnete Worthülsen übersetzt und genölt wurden.
In Deutschland ging alles
entweder rechts, zwo, drei, vier
oder links, zwo, drei, vier.
Nicht nur, aber auch im Viervierteltakt trafen sich die Pole. Daran hatte Eisler nichts ändern können.
Und auch der Beat bekam bei seiner Arisierung diesen deutschen Schlag.
Heino war nur was für rechte Mumien.
Die Animals, die Doors, die Stones oder Jimmy Hendrix auf Deutsch beim ersten Mai?
Allein der Gedanke verursachte bei Tally erhebliche Zahnschmerzen.
Eine Flatsch-Version auf hessisch hätte er sich noch vorstellen können, eine auf Kölsch mit BAP auch.
Das Problem war nur die geringe Verbreitung der Dialekte, Deutschland war und blieb kleinkariert, auch sprachlich.
Der schwarz-amerikanische Slang wurde überall auf diesem riesigen Halbkontinent verstanden, das verwandte Kreolisch in der gesamten Karibik.
Brother klang nicht so martialisch wie Genosse.
Nicht so gewerkschaftsbürokratisch wie Kollege. Und mit dem Kumpel auf den Lippen logen sich die DGB-geprüften, DKP-geschulten Musikfunktionäre volkstümelnd an die Prolos heran.
- Amerikanisch war authentischer,
- klang zumindest so.
Aber Tally wußte auch, wo der Pferdefuß herausschaute.
Brother konnte sich jeder nennen, wenn er feeling zeigte.
Das eröffnete fließende Übergänge.
Zwei schwarze Generäle,
drei farbige Senatoren,
ein Oberbürgermeister in gelb oder braun,
GM-gesponsorte schwarze Spitzensportler
und James Brown als Befriedungsmarionette
gegen die Aufstände in den schwarzen Ghettos.
Vor einem Vierteljahrhundert fast eine Revolution.
Und heute?
Ein Bimbo kommandierte die US-Streitkräfte.
(Manchmal rutschte auch Tally der Hanauer Alltagsrassismus über die Lippen.)
Da war nichts mehr von Klassenzugehörigkeit zu hören,
höchstens als drittrangiges Merkmal eines Bothers, einer Sister. Und Martin Luther Kings: „I had a dream“, sagte auch nicht so präzise, wohin sein Traum zielte.
Ein schwarzer Präsident in Washington war genauso denkbar wie ein farbiger Aufsichtsratsvorsitzender bei Dow Chemical.
„Times they are a changing..“
Auch damit konnte der Robert Bob Zimmermann-Dylan mehr gemeint haben, als man damals darunter verstand.
In Hanau gab es eine Reihe von prominenten hugenottischen Fabrikanten, hohen Würdenträgern, zumindest einige Jahrhunderte, nachdem die Hanauer Grafen sie in die Stadt geholt hatten. Zugegeben, sie waren keine ins Land geholten und geraubten Sklaven, die als Tiere gehandelt wurden.
Sie waren gefragte Handwerker, Kaufleute, Fabrikanten, Wissenschaftler, des Schreibens und Lesens kundig, wenn auch nicht des Deutschen.
Sie hatten keine exotische Hautfarbe und sie hatten vergleichsweise schnell die gleichen Rechte wie die Eingeborenen.
Und ihre Namen signalisierten Hochkultur: Savigny, Pelletier, Lafontaine, Boussonville, das Hanauer Telefonbuch war voll davon.
Ähnlich und ganz anders war es bei den Polen. Stankowski, Grabowski, Skovsky, Borowsky, Jankowski, Bednarz oder Bednarsky, egal ob mit Y oder mit I.
Die hängengebliebenen Zwangsarbeiter bei Heraeus und Dunlop
und ihr Kauderwelsch…..
„Hängengebliebene Zwangsarbeiter“ welch geniale Doppeldeutigkeit.
Der Bus fuhr an und gab Tally den Ruck, den er sich längst selbst hätte geben müssen. Er durfte nicht mit leeren Händen bei der Redaktionkonferenz erscheinen.
Jetzt stoppte der Bus schon wieder.
Draußen nahm das Gewitter sintflutartige Ausmaße an.
Der Sturm hatte sich gelegt.
Dafür schüttete es wie aus Badewannen.
Von der Hutkrempe tropfte lauwarmes Regenwasser in den heruntergerutschten Ärmel seines Lodenmantels.
Tally schloss die Lüftungsklappe, was ihm wieder einen dankbaren Blick seiner Nachbarin einbrachte.
Willi Lang nutzte die erneute Wartezeit, um sich auf die Sitzung vorzubereiten.
Er hatte seinen Feuilettonbeitrag für die Samstagsausgabe schon seit Wochen auf Diskette und mehrmals geschoben, von sich aus, da er unsicher war, ob er ihn bringen konnte.
Wieder ein kleiner Racheakt und wieder knapp an der Toleranzschwelle des Anzeigers.
„Der Antiamerikanismus der ‚Linken‘ trägt rassistisch-nationalistische Züge“.
Eigentlich eine Nummer zu groß für den Hanauer, aber Tally mußte ihn hier veröffentlichen. Es ging ihm um die lokalen Bezüge, es ging ihm nicht um „die Linken“ sondern um die Hanauer Linke.
Es gab noch offene Rechnungen.
Er wollte mit einem Verweis auf den ‚Antizionismus‘ im linken Spektrum, die Verbindungen der Roten Armee Fraktion zu arabischen Staaten und deren frühe Beziehungen zu geflüchteten Nazigrößen aufdecken und den Bogen zu den aktuellen Aktionen der Linken und Autonomen gegen die US-Army schaffen.
Der volkstümliche Nachkriegs-Antiamerikanismus und Rassismus bot den Nährboden für rechtsradikale „Nationale Befreiungs“-Parolen und der Ruf „Ami go home!“ war alles andere als ein Empörungsschrei geknebelter Demokraten.
Es war der Ruf übriggebliebener Nazis und deutschnationaler Elemente, der sich in den fünfziger Jahren mit den nationalen Vereinigungstönen der stalinistisch beherrschten Organisationen in Hanau vermischte.
Tally war sich darüber im Klaren, daß er mit diesem Beitrag im Hanauer Anzeiger auf des Messers Schneide reiten würde.
Der Seniorchef des Verlages gehörte zu den Kriegsgewinnlern.
Die evangelische Waisenhausstiftung hatte den Waisenhaus-Anzeiger-Verlag, die dazugehörige Akzidenzdruckerei und die gesamte Liegenschaft ihrem in die NSDAP eingetretenen Geschäftsführer zu einem symbolischen Preis notverkauft, um die Substanz der Stiftung und die Zeitung vor dem Zugriff der Nazis zu retten.
Nach dem Krieg verweigerte der Herr dann die Rückgabe.
Und wartete nicht all zu lange, bis ihm die Militärregierung die Lizenz für den Anzeiger erteilte.
Der Mitläufer sollte wieder mitlaufen. Die erste harte Anti-Nazi-Truppe der Amis war abgezogen worden. Dwight D: Eisenhauer hatte Trumans Aussage nach der Konferenz von Malta sehr gut verstanden: „Wir haben das falsche Schwein geschlachtet!“. Antifaschismus war passé – Antikommunismus war angesagt. So passte auch der Anzeiger-Senior als schnell geläuterter Gelegenheits-Nazi bestens in den Aufbau der neuen Front. Die protestantischen inneren Widerständler in der Waisenhausstiftung waren keine Garanten für harte Schläge gegen Kommunisten.
Bevor er zum Anzeiger ging, hatte Willi Lang unter Pseudonym diese Story schon mal der Offenbach-Post, dem Main-Echo und der Frankfurter Rundschau angeboten. Doch das war damals wie mit den Kunstfehlern bei Ärzten oder der juristischen Verfolgung von Nazi-Juristen durch bundesdeutsche Gerichte. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Tally mußte bei solch sensiblen Themen sehr präzise arbeiten, um die Befindlichkeit in der oberen Verlagsetage nicht anzukratzen.
Er durfte auch nicht die Volksseele im Mark treffen, nicht die schnell entnazifizierte Hanauer Geschäftswelt, das haute sonst ins Verlagskontor.
Der Anzeigenmarkt war hart umkämpft.
Besonders musste und wollte er den Eindruck vermeiden als arbeite er der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und anderen kryptokommunistischen Gruppierungen in die Hände. Doch sein plakativer Antistalinismus war stadtbekannt. Seine diffuse Distanz zum betonierten Funktionärskern der Alt-SPD hatte er von 68 bis in die 80er hinübergerettet, was sich jetzt als aufstiegsfördernd erwies. Denn auch alle historisch gewachsenen Volksfrontseilschaften konnten den Vormarsch der Schwarzen nicht aufhalten.
Die linken Sekten waren chancenlos, wie die Anarchisten oder die, die sich im Revoluzzer-Streetfighter-Outfit dafür hielten, ohne einen blassen Dunst einer Ahnung von anarchistischer Theorie und Praxis zu haben.. Die meinten halt die Anarchie käme gerade so aus dem Chaos ihrer WG-Küchen oder aus dem Bauch. Auf selbigem würden sie früher oder später auch landen. Bis auf diejenigen, die noch rechtzeitig den bürgerlichen Heimathafen wieder ansteuern konnten.
Und die Grünen, diese selbsternannten Alternativen. Eine Mischung aus altgewordenen Naiven und machtgeilen Restbeständen aller 68er Strömungen, die zum letzten Gefecht um Posten und Pöstchen angetreten waren. Und dann die Spätschalter, die Arbeitstiere, die vereinigten Kräfte aus dem VDI-ML, dem Verband Deutscher Ingenieure – Marxisten-Leninisten, die bereits 1968 wie üblich zu spät kamen und heute dementsprechend die grüne Nachhut bildeten und nibelungentreue schworen, wenn’s vorne bereits bröckelte. Geisteswissenschaftler wie er, gehörten schon immer zur Vorhut, genau so, wie sie als Erste auch wieder vom Zug absprangen, wenn’s brenzlig wurde. – Die Mobilgarde der Revolution –und der Konterrevolution.
Bei diesen Gedanken und Begriffen, Worten rollte sich seine Zunge automatisch zum Rodenbacher „R“, zum „R“ der Wetterau, wo er als Kulturhistoriker die „Rrourerriewerobbmaschien“, dieses frühindustrielle Rübenerntegerät, als Synonym einerseits für den Sozialisten fressenden Bismarckschen Staatsapparat aber auch für den sozialdemokratischen Parteiapparat erforscht hatte.
Die Technische Intelligenz war spät gekommen, doch sie entwickelte im Gegensatz zu den Geisteswissenschaftlern bei den Grünen gesellschaftspolitische Visionen – Utopien – reale Utopien. Dass sie gerade dabei waren diese an und für sich genommen herrlichen Utopien auf ein linksliberales Mittelschicht-Mittelstandsförderprogramm zusammen zu kürzen, das konnte die nicht wissen. Diesen Mittel-Klassigen Fachidioten hätte jeder durchschnittliche Psychologiestudent im zehnten Semester auf den Kopf zusagen können, dass sie ihren guten Riecher für kommende Marktlücken und –Nischen unbewusst und mit bestem Gewissen und politischer Jungfräulichkeit ins Wetterleuchten einer sanften Revolution umdeuteten. Aus diesem blühenden antiautoritären Kindergarten würden sich Siemens/Degussa usw. schon bald bedienen können. Einige wenige würden es schaffen -–vom Solarbastel-Freak zum Solar/Silicium-Bereichsleiter, von der Alternativ-Werkstatt zur Aktiengesellschaft.
Und die erfolgreichen alternativen Neureichen hatten auch gleich noch ihre Rechtfertigungsideologen:
die verwandlungsfähigsten aus den gemeinsamen Kampftagen.
„Man muss das Kapital eben mit dem Geldbeutel schlagen!“,
hatten bekannte K-Gruppenhäuptlinge von sich gegeben.
Oder noch besser von weiter linksaußen:
„Wir hatten vergeblich versucht, die Börsen als Sitz des Bösen hochgehen zu lassen. Jetzt stehen unsere Ideen hoch im Kurs und unsere Aktienkurse gehen hoch. Lasst uns die Börse von innen erobern: Volks-Solarmodule, Volks-Solaraktien,
Wir wollen alles…“
Das galt für Frankfurt.
Hier in Hanau kommt’s erst später.
Doch ganz klein und bescheiden fing es auch hier schon an:
– Wer die Krone nicht kriegt – macht aus Kuba eine Kommanditgesellschaft!
Musste ja so kommen, nachdem die meisten Besucher dieser Hanauer Musik-Kneipe dachten, sie wäre nach dem Gesöff benannt. Und dabei hatte Kuba Libre erheblich mehr mit Revolution zu tun als der Hanauer Kultur-Bazar.
Ein heimliches Grinsen konnte sich Tally angesichts des Anlasses für seine Antiamerikanismus-Artikel nicht verbeißen.
Und eigenartigerweise meinte er auch bei Little und der Verlagsleitung eine Spur von hämischem Feixen zu entdecken.
Das bestätigte ihn bei seinen Thesen zum Antiamerikanismus.
Hier gab es eine verdeckte Verbindung zwischen deutsch-nationalen Honoratioren
und linken Chaoten.
Zwischen dem schwarzen Block auf der rechten
und dem auf der linken Seite.
Die Geschichte war köstlich,
Tally wäre gern dabei gewesen,
vor zehn Jahren hätte er sie sicher noch mitinszeniert:
Bei der Verabschiedung des Standortkommandierenden der US-Army in Hanau
sollten Paradeeinheiten wegen anhaltend schlechten Wetters
statt auf dem Neustädter Markt im Rathausfoyer exerzieren.
Akrobatik mit aufgepflanzten Bajonetten.
Unter die versammelte Provinz-Hautevolee hatten sich einige Autonome
aus der Anarcho-Szene gemischt und getrocknete Erbsen gestreut.
Nachdem die ersten Vertreter des US-Imperialismus über die Erbsen gestolpert
und mit ihren Menschenfleischspießen Richtung Publikum geschliddert waren,
wurde die Feier abgeblasen.
Die Frankfurter Rundschau meldete mit kaum versteckter Sympathie:
„Erbsen bedrohen die Sicherheit der US-Streitkräfte“.
und in den linken Postillen erschienen prustende Überschriften.
„Wie der US-Imperialismus im Hanauer Erbsenkrieg gestürzt wurde“
Geschichten, wie sie das Leben selten so satt und drall schrieb.
Als Tally um zwanzig nach fünf mit triefendem Hut das Verlagsgebäude in der Hammerstraße betrat, hatten sich die Gewitterwolken bereits aufgelöst.
Zumindest die am Himmel.
Tallys Aufwallungen im Öffentlichen Nahverkehr
in der ersten Version dieser Erzählung, dieses Moduls aus dem Roman-Zyclus „GRENZGÄNGER“ hieß Tally noch Willy, in „echt“ heißt der Held der Erzählung, der frühere Aktentaschenträger des ZdF-Granden Dieter Zimmer mit dem Verschlüssel-RomaNamen Peter Kammer, mit Spitznamen „Shorty“, aber ich brauchte eine etwas längere Romanfigur. Da habe ich zwei nachezu gleiche Charaktere und nur verschieden lange Mannsbilder zu einem zusammengeschmolzen, Nein, in ihren wirklichen Leben heißen die beiden weder Schmelz noch Schmalz, nur eine Figur hat halt einen etwas kurzen Hals, Gott vergelt’s & Shorty, worum ich Dich jetzt bitten tät: Du mir bitte net!
Erzählung aus dem
Prosa-Zyklus Grenzgänger
Der schwarze Lodenmantel wölbte sich beim Einsteigen in den Bus
wie ein Segel im Wind.
Tally schaffte es eben noch, ihn einzuholen, bevor sich die Türe schloss.
Fast wäre er hängen geblieben.
Mit eingezogenem Genick, die linke Hand am breitkrempigen Hut,
in der rechten den Fahrtausweis, hangelte er sich am Fahrer vorbei zwischen den stehenden Fahrgästen hindurch zur Busmitte.
Nahverkehrsakrobatik.
In Bohemegarderobe bei fast dreißig Grad im Schatten.
Doch Hut und Loden mussten sein.
Tallys Statussymbole.
Längst nicht mehr notwendig,
aber zur zweiten Haut geworden.
Der Bus war berstend voll.
Freitag Nachmittag.
Berufsverkehr.
Alles, was nicht in endlosen Blechkarawanen ersticken wollte, quetschte sich in die Busse zum Westbahnhof, zum Freiheitsplatz, drängte zum Hauptbahnhof auf der Flucht ins Umland.
Feierabend.
Er bekam keinen Sitzplatz, mußte stehen.
Ungerecht, dachte er, die gehen ins Wochenende,
ich habe noch etliche Stunden vor mir.
Am Marktplatz würde ein Teil aussteigen,
Zwischenstop für eilige Einkäufe oder fürs Abschalten im Stehcafé.
Davon hatte er aber nichts.
Dort mußte auch er raus.
Die Fahrt ging im Schritttempo.
An jeder Haltestelle zwängten sich Pkws trotz des ununterbrochenen Gegenverkehrs am Bus vorbei nach vorne,
während Tally seinen Stehplatz gegen aufrückende Passagiere verteidigen mußte.
War es Standhaftigkeit, Beharrungsvermögen, war es die Gravitation?
Immer zog es ihn in die Mitte des Busses und hielt ihn dort,
wo er sich am sichersten fühlte.
Die Mitte bot Schutz vor den dauernd lauernden Gefahren.
Aber es war nicht nur die Angst eines crash-dummies,
dem von allen Seiten Aufprallangriffe drohten:
von links, von rechts von vorne von hinten.
Von Oben und Unten, das war nicht so wichtig,
wann stürzte schon mal ein Flugzeug auf die Stadt, wann schlugen Meteoroiden ein, wann gab es im Rhein-Main-Gebiet größere Erdbeben oder Sintfluten?
Es war die Anziehungskraft des Schoßes,
das Zentrum des weiblichen Körpers zog ihn mit magischen Kräften in die Mitte. Die Frau, der Bus, die Bach, der Brill. Auch die hessische Grammatik gab dem Bus nichts Feminines. Oder fahren in Hanau trotz dieser Geschlechtsregelung weibliche Busse ? Immerhin waren es Busse der Hanauer Straßenbahn AG und damit Tram-Ersatz. Die Tram. Und er reagierte instinktiv auf dieses nur oberflächlich vermännlichte Wesen
Psychologistischer Mist!
Es waren die frühen Straßenbahnerfahrungen aus den fünfziger Jahren,
als er mit seiner Mutter zwei, drei Mal im Jahr vom Frankfurter Ostbahnhof aus
zur Zeil zum Kaufhaus Schneider oder in den Zoo gefahren war,
mit der Tram.
Der Uniformierte mit der Hängekasse vor dem Bauch,
die auf Daumendruck schier endlos Groschen ausspuckte,
dieser Hoheitsträger hatte jedes Mal in mühsam angelerntem Hochdeutsch gerufen: „Bitte in die Mitte gehen!“ Diese Respektsperson, die mit einem Strippenzieher, einem Klingeln ein riesiges Monstrum in Bewegung setzen konnte. Alles musste ihr gehorchen!
Schaffner, Kontrolleur, Kassierer, ja sogar Zugführer, kein Militär-Zug-, kein D-Zug nur ein Straßenbahn-Zug aber immerhin ein Zug-Führer, eine Führer-Persönlichkeit:
not very big; but a leader!
Tally war sich nicht sicher. Möglicher Weise kam seine Sucht zur Mitte und das dazugehörige Zitat aus einem Lied von Weiß-Ferdl oder von Karl Valentin:
„Ein Wagen von der Linie Acht, weiß-blau fährt ratternd durch die Nacht…“
Das musste Weiß-Ferdl gewesen sein! Der gesprochene Refrain: „Bitte in die Mitte gehen..“
Die Luft im Bus war schwül und schweißgeschwängert.
Seine Körpergröße brachte ihm hier keinen Vorteil.
Er hatte zwar freie Sicht über die dichtgedrängten Köpfe,
aber der Mief war unter der Decke am dicksten.
Tally hielt sich über Kopf mit einer Hand an der hinteren Stange der Lüftungsklappe fest und versuchte mit der anderen, sie zu öffnen.
Die Klappe klemmte. Eine Klappe die klemmt statt zu klappen musste eigentlich Klemme heißen. Klemme aufklappen, nichts einklemmen, zuklappen, zuschnappen, einschnappen. Halt mal die Klappe, nein, er wollte die Klappe nicht halten, er wollte sie öffnen, was nicht klappte. Vielleicht war diese Klappe jetzt nur etwas eingeschnappt. Der Widerstand der Klappe – nicht von Pappe, dem Ritter viel die Klappe, dann kämpfte nur sein Knappe, saß im Rappen, Helles zappen, Bier verklappen, weg der Lappen, die Pappe im Eimer, Pappenheimer, Pappenkappen.
Papperlapapp.
Klappe!
Oh je, hatte er das jetzt laut gesagt?
Klappe! Die Zweite.
Er stemmte sich rückwärts dagegen.
Erfolglos.
Erst beim zweiten Versuch gab die Klappe ruckartig nach,
seine Hand stieß kurz ins Leere, er verlor sein Gleichgewicht
und konnte sich nur durch einen Ausfallschritt nach hinten auf den Beinen halten,
wobei er nicht auf seinem sondern einem fremden Fuß zum Stehen kam.
Die schwarzverschleierte Frau hinter ihm autschte kurz auf.
Tally lief rot an und stammelte eine knappe Entschuldigung.
Die Frau verzieh ihm lautlos mit mild lächelndem Augenaufschlag
und gab ihm zu verstehen, daß der kühlende Luftstrom aus der Klappe
sie für seinen Fehltritt entschädigte.
Zwei, drei Mitfahrer musterten den schwarzen Filzhut und den Lodenmantel
mit verständnislosem Kopfschütteln.
Einer kommentierte halblaut:
„Wonn der kaan Hitzschlach krieht.“
Tally fing trotz des Fahrtwindes an zu schwitzen.
Er ignorierte die Blicke und schob seine Hutkrempe tiefer in die Stirn.
Schweigen im Bus.
Die Körper um ihn herum schwankten
im unregelmäßigen Takt der Kurven und Schlaglöcher,
der Beschleunigungs- und Bremsmanöver.
Normalerweise beruhigte ihn das, versetzte ihn in Trance
mit kaum spürbarem Pulsschlag,
in die Halbschlafatmosphäre morgendlicher Pendlerzüge.
Je nach Tageszeit und Leistungskurve, Alter oder Adrenalinspiegel
konnte man dabei einnicken oder im Takt mit den Füßen wippen,
mit den Fingern schnipsen und im Stehen kaum merklich die Hüften schwingen.
Im Bus klappte das nur selten,
und wenn, dann kurz und schlecht.
Beim Busfahren war der Blues jedenfalls nicht erfunden worden.
Da gab es keine sich endlos wiederholenden immergleichen Taktfiguren.
Im Zug war das anders.
Train und Blues gehörten zusammen.
Früher als Fahrschüler hatte er oft so seine Endstationen verschlafen oder in den Zwischenabteilen endlos die neuesten Hits gegrölt, unterbrochen nur von Haltepunkten und Dorfbahnhöfen, Einsteigern und Aussteigern.
Mit Onkel Werres‘ Schlagerbörse aus Frankfurt war er groß geworden.
Das Rattern der Räder war Schlaflied und Playback.
Die Zwischenabteile waren Tallys Proberäume,
viel besser als Duschkabinen und Badewannen.
Auch die öffentlichen Badeanstalten waren trotz ihrer ausgezeichneten Akustik nicht besser geeignet, weil er dort in schönster Regelmäßigkeit von hirn- und beinamputierten Rentnern erwürgt wurde: „Hör sofott uff mit dere Neeschermussikk, sunscht haach isch derr die Krigge um die Ohrn.“
Das war noch einigermaßen zu ertragen, dagegen ließ eine hochdeutsch geschmetterte Aufforderung deutsche Lieder zu singen Tally gleich doppelt verstummen, äußerlich und innerlich. Solchen Aufforderungen pflegten bei Nichtbefolgung außerordentlich standrechtliche Erschießungen zu folgen.
Alptraumhaft bedrohlich und gleichzeitig bis zur kalten Gänsehaut faszinierend war es, wenn die Bereitschaftspolizei in halber Kompaniestärke zum Schwimmen ins Heinrich-Fischerbad einrückte. Da wurde Tally winzig klein, da platzten die stumpfen Kacheln ob des röhrenden Jungmannengesanges von den Duschwänden und begruben ihn unter sich.
Doch es waren nicht nur diese alten Blockwartsseelen, bei denen man nie wußte, wann sie die Gemeinschaftsduschen von Wasser auf Gas umstellen würden, es war nicht nur das Grölen der Marschkolonnen, das Knallen der Stiefel auf dem Asphalt, was ihn verstummen ließ. Auch nicht die Schiffsschraubenähnlichen Bewegungen rasender Arme und Beine, wenn eine Hundertschaft braunknackärschiger oder weißarschschwabbelnder GIs in Unterhosen versuchte das Schwimmen zu lernen und ihn im Wasser zu zerstückeln drohte.
Es war noch eine andere Angst, die ihn zum Schweigen brachte, und die war schon da, bevor die kaltduschende Manneszucht ihn im Hallenbad erwischte.
Zwischen sinkendem Knabensopran, Stimmbruch und erstem Oberlippenflaum traute er sich nicht, seine Lieblingssongs nachzusingen, wenn andere zuhörten.
Dazu mußte er im zugigen Dämmerlicht zwischen klappenden Toilettentüren und Waschräumen eines Zuges alleine sein.
Hier konnte er unbeobachtet der Körpersprache seiner Idole nachspüren, Sprünge und Tanzfiguren ausprobieren, ohne daß ihn Schulfreunde auslachten, weil diese Imitationsversuche wegen seiner Schlaksigkeit eher wie misslungene Karikaturen wirkten.
Hier brauchte er nicht die abschätzigen Blicke der heimlich nahegewünschten Mädchengesichter fürchten,
Blicke, denen er es später einmal zeigen wollte.
Am liebsten sang Tally bei Stromausfall in den Morgenstunden oder auf Tunnelstrecken. Da träumte er sich auf die großen Bühnen neben Elvis, Blue Diamonds, Animals und Ringo Star. In den Ami-Clubs hatte er sie zum Greifen nahe gehabt, wenn er schmachtgelockt hinter den Vorhängen in den Fensternischen versteckt den Tillman Brothers nachgrölte und nur die Luft anhielt, um der MP und Hanaus Polizeichef Holbein nicht in die Hände zu fallen.
Holzbein, die Rittmeisterhosen stramm um die Prothese geschnallt machte immer höchst persönlich Jagd auf Halbstarke im Lamboy-Viertel rings um die Kasernen, Regelmäßig unregelmäßig donnerte der auf seiner Dienst-BMW -oft im Stand, wie bei einer Parade- mit gezogener Pistole durch die Lamboystraße. Garry Cooper und John Wayne konnten gegen ihn einpacken.
Er war das Gesetz.
Holbein hatte als Rittmeister vor und während des Krieges genügend Erfahrung im Umgang mit willenlosen Befehlsempfängern und Untermenschen gesammelt.
Zurück aus Russland wurde der drahtige Bulle trotz Amputation an der Heimatfront dringend gebraucht zum Kampf gegen Kriminelle und Kommunisten, was für ihn nicht das Gleiche war.
Für ihn waren die Roten schlimmer.
Sheriff Holzbein war Law and Order und über ihm
– bis weilen auch nur neben ihm –
standen nur noch die Präsidenten der Vereinigten Staaten, die er der Reihe nach duzte, wenn sie gelegentlich übern Teich kamen und in West-Germany und Hanau vorbeischauten.
Dwight, JFK, Nixon, LBJ, Dicky George, sie alle konnten sich auf Holzbein verlassen.
Er hatte alle und alles im Griff.
Holzbein sah alles, fand jeden Verbrecher und wen er dafür hielt, Juden, Zwangsarbeiter, DP’s, Zigeuner.
Nur eines hatte Holzbein übersehen, die Fensternischen im Skyline,
und einen hatte er nie gefunden, Tally blieb im Dunkeln unbehelligt.
Sein Stehplatz auf der Fensterbank, umhüllt von Lärm und nikotingebräunten Vorhängen barg ihn wie das Dämmerlicht im Zug, das Kreischen der Bremsen, das Hämmern der Räder auf den Schienen, hier hörte niemand sein Heulen und Singen.
Die Tillmann-Brothers waren laut und schrill genug.
Die Zwischenabteile boten Tally auch in anderer Hinsicht geliebte Stehplätze, wenn es morgens im Gerangel zwischen kaufmännischen Angestellten, Verkäuferinnen und Mitschülerinnen angenehm eng wurde.
Zielschieben nannte Tally das scheinbare sich Treibenlassen zwischen den noch schläfrigen Leibern.
Da streifte er Schenkel und Backen, Brüste und Arme, streichelte mit Mund und Nase ganz absichtslos Pferdeschwänze, Zöpfe und verrutschte Hochfrisuren.
Mit geschlossenen Augen saugte er Duftmischungen
aus noch warmem Nachtschweiß, Haarspray und Parfüm
in sich auf.
Tally wußte genau, wohin er sich treiben ließ.
Er war groß und verlor so selten den Überblick.
Zielschieben.
Das war damals schon fast Tanzstundenfieber.
Die etwas früh entwickelten Engelsbrüste der achten Klasse konnte er nur im Zwischenabteil erreichen. An die der neunten, zehnten oder gar der Elften wagte er kaum zu denken.
Draußen waren sie alle für ihn unerreichbar.
Tally hatte aus seiner langen schlaksigen Not eine Tugend gemacht.
Die allseits begehrten Brüste lagen, nein sie standen unter seinem Niveau.
Zunächst nur – zu seinem Leidwesen- unabänderlich topographisch. Dann aber auch seelisch und geistig.
Denn Tally pflegte als Ausgleich für sein wenig glänzendes Äußeres seine inneren Werte mit Philosophie, Politik, Religion und Sozialkunde.
Er fühlte sich dabei zwar wie jemand, der seinen Durst mit Knäckebrot stillte, doch er sah für sich keinen anderen Ausweg.
Nur im Dunkel der Tunnelstrecken, im morgendlichen Gedrängel der Zwischenabteile und Gänge mit ihrer übernächtigtfunzelig flackernden Notbeleuchtung konnte er die spartanische Maske, sein durchgeistigtes Korsett fallen lassen und sich seinen animalischen Instinkten und Bedürfnissen hingeben. Treiben – treiben lassen, sich treiben lassen – treiben, es treiben, wenn es satt klatschte und schmatzte.
Verrucht und spannend.
Der Kragen seines Seidenhemdes spannte am Hals wie die Vorhaut um die schwellende Eichel.
Hastig knöpfte er auf, was ihn beengte und wunderte sich dass er zum Hemd und nicht zur Hose griff.
Tally blickte unter seiner Hutkrempe in die Runde, suchte nach Bildern, nach den umflaumten Gesichtern und den kleinen festen Brüsten, die die Last der Kurven und Schlaglöcher, das ruckende Wechseln vom Gas zum Bremspedal zur Lust gemacht hätten.
Wie früher im Zug
und nur da.
Draußen wollte keine zu ihm auf den Soziussitz.
Er hatte kein Moped und die Querstange seines Fahrrades brachte blaue statt Knutschflecken.
Ihm blieb das Zwischenabteil für zwischenmenschliche, zwischengeschlechtliche Beziehungen.
Hier hatte er, wenn auch viel später als die anderen in seiner Klasse, den ersten Übergang vom Nachhintenstolpern zum weichen Zurückweichen erlebt, den ersten Gegendruck im Dunkeln beim plötzlichen Wiederanfahren des Zuges, die ersten verstehenden Augenblicke, wenn das Licht wieder aufflackerte und er sich mit schlecht versteckter stolzgebeulter Hose und schwellender Brust auf den kühn-frühen und kühlenden Absprung aus dem noch fahrenden Zug vorbereitete, um vor der ungewissen Fortsetzung, seinem drohenden Versagen oder der befürchteten Abweisung zu fliehen.
Tally traute sich nur langsam weiter.
Seltene und beängstigende Lustgefühle, wenn aus den Petticoats kurz vor dem Absprung Pettingcoats wurden, Hände und Lippen nicht nur feucht vor Angstschweiß, das Herz in die und sein Schwanz aus der Hose rutschte, die Knie weich und ergriffene Brüste und Pimmel hart wurden.
Was sich da absichtslos und absichtsvoll rieb, erzeugte unerträgliche Spannung, drängte nach Entladung. Ein Funke hätte genügt, eine weitere Berührung. Doch meist ging das Licht wieder an, war der Tunnel zu Ende, tauchte ein Schaffner auf oder der Zug fuhr mit quietschenden Bremsen im Hauptbahnhof ein.
Schwanz oder Pimmel, Fotze oder Möse, Titten oder Brüste, sein Wortschatz für Unbeschreibliches, Unentdecktes, wie die Zielgebiete seiner frühen Forschungsreisen war begrenzt wie das Weltbild deutscher Bauern im frühen Mittelalter. Seine Gefühls- und Begriffswelt glich der Erdenscheibe vatikanischer Weltkarten, umzingelt von einem undurchdringlichen Ring weißer Flecken. Am Rand drohte der Absturz in unendliche Schrecken, in höllisch-barbarische Pein.
Ich bin klein, mein Herz ist rein.
Von wegen!
Groß war er und das mit der Reinheit beschränkte sich in der Regel auf seine Nyltest-Oberhemden, die ihn zum Waschzwang zwangen, weil die unvermeidliche Synthese von Nylon und Schweiß sofort einen Geruchscoctail aus Katzenpisse und Buttersäure produzierte und seine Nase auf die Spur zu den abgelegten Strumpfhosen seiner älteren Schwester heftete.
Die stanken genau so.
Besonders in der Mitte.
Er hatte Schwierigkeiten mit all diesen erbsündig glitschigen Dingen unter der Gürtellinie, am Rande der Wildnis, vor dem Abgrund zur Hölle, auf denen man leicht ausrutschte und auf die schiefe Bahn geraten konnte
Bleib weg vom Rande und vermehre dich ehelich.
Tally brauchte lange, um sich in diesen Dschungel vorzuwagen, heimlich zunächst, ängstlich, verklemmt, voller Schuld- und Schamgefühle. Doch der Ruf des Dschungels hatte ihn erreicht, gelockt und gefangen. Ganz anders als Tarzan seine immer frischgeduschte und geföhnte Jane.
Er begann zu befühlen und zu begreifen und zu benennen. Die vorfindlichen Namen machten ihm die Wortwahl oft zur Qual bis zum Stottern.
Aber das war noch vor der Zeit der Züge und zugiger Zwischenabteile.
Oder doch nicht?
Wenn Tally ehrlich mit sich selbst war, was ab und zu
passierte, mußte er zugeben, daß er dieses beklemmende Stottern,
diese stotternde Verklemmtheit angesichts nackter Tatsachen bis
heute mit sich herumschleppte. Trotz seiner 68er Wilhelm Reich-Schulungen und trotz der sogenannten sexuellen Revolution.
Die richtigen Worte.
Schwanz war ihm als Pennäler zu brutal und zudem anatomisch falsch – diese Erkenntnis hatte er aus
dem Biologieunterricht .
Er konnte kaum seine eigenen Geschlechtsorgane begreifen,
geschweige denn die weiblichen.
Penis war ihm zu wissenschaftlich trocken, obwohl das „nis“
nach dem „Pe“ phonetisch schon nass genug war.
Aber es ließ die ergreifend himmlisch-höllischen Gefühle außen
vor.
Er entschied sich für das eher kindlich klingende Wörtchen
Pimmel, das den witzigen kleinen Kerl, mit dem er sich langsam anfreundete, in jedem Zustand und jeder
Lage, sein aufmüpfendes unbeherrschtes Verhalten angemessen beschrieb
Pimmel, das klang wie ein junger, ausgelassener Hund, den man
gewähren lassen mußte, der sich an jedes Bein heranmachte, wenn
es ihm gerade danach war.
Sich mit den weiblichen Weichteilen zu befassen fiel Tally um
einiges schwerer.
Sie zu bezeichnen, ohne sie gesehen zu haben war ihm unmöglich, sie
zu begreifen, ohne sie zu fühlen ebenfalls.
Fotze klang ihm zu tierisch, verurteilend, abwertend. Es klang
zwar feucht, so wie er sie zum ersten Mal ertastet hatte, aber
eher nach Rotze und damit verband er Ekel, obwohl er sich
durchaus gerne ob des salzigen Geschmacks in unbeobachteten
Momenten in der Nase bohrte, ausgiebig und mit Lust. Auch heute noch.
Vagina und Klitoris klangen wie eine griechisch-römische
Freistil-Tragödie aber auch -trotz der feuchtklingenden Klitoris
gerade so wie Penis wissenschaftlich trocken und Tabu-belagert.
Möse fand er nach anfänglicher Abwehr mit der Zeit am passendsten:
gemütlich warm, feucht und nicht zu hart, bisweilen saftig wie Ananas in der Südsee. Muschi war zu Infantil, so konnte man allenfalls eine Katze nennen. Bei Muschel wurde ihm schlecht, so wie ihm bei seinem ersten Versuch Paella zu essen speiübel geworden war.
Er brauchte Miesmuscheln nur zu sehen, prompt überkam ihn heftigster Brechreiz. Austern kannte er nur von den Perlmuttknöpfen an der Bettwäsche, der Perlenkette seiner Mutter und vom Biologieunterricht: ein Film über Austernfischer, Perlentaucher und Austerngerichte in einem Schlemmerlokal. Er hatte sich in sein Hirn eingebrannt, so tief wie später die surrealistischen Filme von Salvatore Dali, wo Ameisen aus offenen Handinnenflächen hervorquollen. Der Gedanke, Austern essen zu müssen, ließ ihn würgen und Bilder hochkommen, die ihn abstießen und gleichzeitig faszinierten: Kühe, die ihre Nachgeburt schlürften, Hunde die sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile berochen und beschleckten. Ein Wechselbad von Ekel und aufschimmernder animalischer Lust.
Tally war in Wallung geraten. Er spürte, daß er rot wurde. Die Menschen um ihn herum mussten seine Gedanken mithören.
Die innerliche Hitze ließ den Schweiß auf seiner Stirn im Luftstrom aus der Klappe eiskalt werden.
Aus der Traum.
Der Bus war kein Zug und Tally stand unter Druck.
Kein Dösen, kein Rock, kein Blues und keine Brüste – zumindest keine erreichbaren.
Die Zeit drängte, um fünf begann die Redaktionskonferenz und Little kannte kein Pardon, wenn der Haufen nicht pünktlich versammelt war.
Auf der Phillippsruher Allee an der Kinzigbrücke war alles vorbei.
Der Bus steckte im Stau.
Willi Lang verlor seine antrainierte Souveränität und wurde nervös.
Er nestelte am Revers seines Edellodens und machte sich mit dem Gedanken vertraut, entweder zu Fuß verspätet und abgehetzt die Redaktion zu erreichen oder aber noch verspäteter mit dem Bus, dafür weniger derangiert .
Eigentlich hatte er gar keinen Anlass zur Hektik.
Als Kulturredakteur genoss er eine gute Portion Narrenfreiheit und selbst von Little bekam er sein Dauerabonnement auf das akademische Viertel zugestanden.
Trotzdem.
Tally hasste es, auch nur andeutungsweise auf Gnade angewiesen zu sein.
Besonders auf die Gnade seines Chefredakteurs.
Dieter Kleine, der kurze quirlige Allroundentertainer, der peitschenschwingende Zirkusdirektor, hatte ihn lange genug spüren lassen, daß er eigentlich nicht dazugehörte.
Erst als die Hassliebe zu seinem Brötchengeber in eine Vernunftehe mit gewachsener Angleichung zwischen Herr und Hund, zwischen Dompteur und Tiger mutiert war, wurde er in die kleinbürgerliche Redaktionsrunde des Hanauer Anzeiger aufgenommen.
Tally als Tiger, als ‚tiger‘
lächerlich.
Seine Elvis-Eskapaden wurden in der Hanauer Rockerszene nur belächelt. Er bekam nicht einmal eine in die Fresse.
Aber etwas war schon dran – am Tiger.
Etwas war hängen geblieben.
Er konnte nach wie vor die Krallen und die Reißzähne zeigen.
Für den Anzeiger war seine Mitarbeit anfänglich ein gewagtes Spiel gewesen.
Tally ging Elvis‘ Tigersong durch den Kopf.
Der Tiger als Symbol für nicht zu bändigende Rebellen.
Der Tiger als Sieger.
Touch me, Tiger.
Gerne wäre er einer gewesen, auch bei den Frauen.
Aber war nix,
weder körperlich noch politisch.
Little hatte ihn wie Esso in den Tank gepackt.
Er verlieh dem Feuilleton dieses Provinzblattes beißenden Glanz, der jedoch jederzeit abzustumpfen drohte.
Das Bild des unbeugsamen Dschungelkönigs schrumpfte in den deutschen Tiger-Adaptionen auf Kuschel-Steiftier-Format zusammen – mit den mühsam einstudierten eckigen Rock n‘ Roll-Hüftleidenschwüngen eines Peter Kraus.
Grässlich.
Tally beschlich das Gefühl welkender Petersilie und schrumpelnder Gelberübenscheiben auf einem in Essig ertrunkenen deutschen Kopfsalattellerchen.
Der Ex-Rebell als Schnitzelbeilage.
Für einen gestandenen und lokal profilierten Altachtundsechziger, wie ihn, war der Aufstieg zum journalistischen Landadel ein zuweilen sehr schmerzhafter Prozess.
Schrumpelnde Gelberüben – „Geele Riewe“ nannte sich der Verein zur Pflege des Hanauer Brauchtums.
Jetzt durfte und mußte auch er mit-„tümeln“.
Das tat weh.
Der Mutationsversuch vom Elvis-Tiger zum Tucholsky-Panther war ihm nicht geglückt.
Mehr Pantoffel als Panther.
Er war auf der Strecke geblieben. Und bekam es zu spüren.
Gerade hier auf der Phillipsruher Allee, auf der Provinz-Kulturmeile
zwischen Kulturbazar, Rheinhardskirche, dem Museum im Schloss Phillippsruh, dem Olof-Palme-Haus, der Pumpstation, dem Jazz-Keller und der Volkshochschule war er bei seinen Kritikvisiten jahrelang Spießruten gelaufen.
Er mußte sich verspotten lassen.
Für ihn hatten nette Menschen aus der Scene den „Mustang Sally“ in „Bastard Tally“ umgetextet. Er kannte die anonymen Texter, die sich in Biographie und Stallgeruch nur um Nuancen von ihm unterschieden. Doch diese fünften, sechsten, siebten Stellen hinter dem Komma hatten entschieden.
Keine Kulturinitiative, keine politische Gruppe lud ihn ein.
Er wurde gemieden,
so als dünstete er den Geruch des Verräters aus.
Er konnte sich lange Zeit selber nicht riechen,
sah sich im Spiegel nicht nur älter und glatzköpfiger sondern auch spießiger werden.
Mittlerweile stand er dazu.
Die anderen hatten gut reden.
Die hatten zum Teil viel früher als er ihre Jobs im öffentlichen Dienst, in der Kulturverwaltung, in der halbwegs etablierten Kulturszene, in den Schulen, in der Gewerkschaft als Teamer, als Psychotherapeuten, als Computerfreaks.
Während er noch eine Existenz als freischwebender Linker fristen mußte, mit Arbeitslosen- und Sozialhilfe, hatten die sich bereits in die Nischen des sozialdemokratischen Kultursumpfes verzogen, und sich dort zum Teil mit Pensionsansprüchen eingerichtet und abgesichert. Oder erklommen, nachdem sie den Anschluss an den rosaroten Eilzug verpasst hatten, den nächsten Bummelzug, der mit grünen Waggons und vorläufig durchgehend zweiter Klasse nach Wartezeit und vielen Zwischenstopps letztlich den gleichen Zielbahnhof ansteuerte.
Mit einem Anflug von Selbstironie nannte er diese Zeit sein Diplomstudium für angewandte Sozialwissenschaften im Bermudadreieck zwischen Arbeitsamt, Krankenkasse und Sozialamt.
Da kannte er sich aus wie kaum ein anderer.
Erst nach seinem steinig-steilen Aufstieg zum lokalen Kulturpapst mit Sitz in diversen Jurys hatten sich die Wogen auf dem Main geglättet.
Sein gesenkter Daumen, seine Kritiken entschieden jetzt über regionale Künstlerkarrieren.
Willi Lang genoss es, auf diese Weise späte Rache nehmen zu können.
Und viele Rütlischwüre einstiger Streetfighter erwiesen sich in den Warteschlangen vor den Kulturpreisrichtern denn auch als Seifen- oder Kaugummiblasen.
War ja alles nicht so ernst gemeint.
Nur wenige waren den Verlockungen öffentlicher Vereinnahmung nicht erlegen, wurstelten in unabhängiger Bedeutungslosigkeit vor sich hin, wurden totgeschwiegen.
Auch sie traf sein Bannstrahl.
Dass ein Provinz-Kulturpreis so gut wie eine Beerdigung erste Klasse war, beruhigte ihn doppelt.
So bekamen alle ihr Fett und der wirklichen Kunst war auch gedient:
Nicht umsonst hieß es ‚das Brot der frühen Jahre‘ und nicht die Torte. Sattheit schadet der Kultur.
Manchmal beneidete Tally diese Handvoll übriggebliebener Hungerkünstler um ihre kohlhaas’sche Standhaftigkeit.
Das Stehen im Bus ging ihm langsam auf die Bandscheiben.
An der nächsten Station könnte er aussteigen. Zu Fuß zur Redaktion waren es höchstens noch zwanzig Minuten.
Ein plötzlich einsetzender orkanartiger Gewittersturm nahm ihm die Entscheidung ab.
Von wegen geglättete Wogen.
Sturmböen peitschten den Main die Uferböschung hoch.
Der Bus schwankte.
Die Wellen klatschten meterhoch gegen die Brücke über der Kinzigmündung.
Das Kloakenwasser spritzte bis an die Scheiben.
Tally ging automatisch in Deckung.
Als er sich wieder aufrichtete, fiel ihm der Dialog zwischen zwei deutschen Putzfrauen ein, den er vor Jahren einmal nach einem Besuch im Skyline-Club an der Francois-Kaserne in Klein-Texas belauscht hatte.
Der fiel ihm immer ein, wenn er sich bei plötzlich einsetzendem starken Regen gerade noch in den Bus retten konnte.
Die Frauen kamen damals vor einem aufziehenden Gewitter zur Bushaltestelle an der Chemnitzerstraße, wo er auf den Spätbus wartete.
Die kleinere fragte die große:
„Take we de Bus oder go we bei feet?“ „Glei werds schitte, we take de Bus.“
Das war Hanau wie es leibt und lebt, in diesem deutsch-amerikanischen Gemisch fühlte er sich zu Hause wie alte Frankfurter zwischen Chaiselongue und Kanapee, Trottoir und Portemonnaie, Plumeau und Fissemantente.
Das Portemonnaie war seit über Hundert Jahren so urdeutsch wie die Toilette, sofern man eine hatte.
Selbst hartgesottene Franzosenhasser gingen mitten in beiden Weltkriegen gegen die alten Erbfeinde nicht gern auf den Abort.
Für das Scheißhaus gab es kein geeignetes hochdeutsches Wort.
Bezeichnendes Indiz für den Entwicklungsgrad teutonischer Kultur.
Die jüngeren Sprachimporte hatten es schwerer:
Pizza und Spaghetti hatten immer noch den Beigeschmack vom Messerstecher, den Döner Khebap übertönte der kameltreibende Kümmeltürke.
Mit dem Amerikanischen war das ein eigenes Ding:
Tally, sein Spitzname ging ihm über die Lippen, wie den vorigen Generationen Jean und Janette.
Vieles ging für viele ohne Zögern als Muttersprache durch, was aus dem Amerikanischen entlehnt war.
Und dann gab es doch Sprachgrenzen.
Zwischen Elvis und James Brown, Zwischen Roger Wittacker und Otis Redding, John Mayall und Jimmy Hendrix.
Trotz der vierzig Jahre in denen Kaugummi und Coca Cola alles eingeebnet hatten, blieb eine Frontlinie stehen, zwischen weißem und schwarzem Amerikanisch.
Das weiße zog man sich gedankenlos rein, der Akzent verschob sich etwas und alles war okey.
Wer aber die Frontlinie passierte, der roch nach Underunderdog, der rangierte noch weit unter der fuselfahnigen Kioskfraktion der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger.
„Briketts“ nannten die Hanauer die schwarzen GI’s, besonders im Kasernen-Viertel Lamboy.
Und was die Wertschätzung dieses Stadtteils für Schwarze betraf, so hieß der nicht umsonst „Klein-Texas“.
Wer sich dort als Frau mit „Briketts“ einließ,
war eine Amischlampe.
Wer einen Weißen erwischte,
war keine.
Da hielt noch der letzte Süffel die Schnapsnase und die Six-pack-Fahne hoch.
Und Amischlampe war fast so schlimm wie Judenschlampe.
Mit dem entscheidenden Unterschied, daß die Amischlampen sich mit den hassgeliebten Siegern eingelassen hatten und nicht mit den noch mehr gehassten Verlierern des tausendjährigen Reiches.
Sieger-Liäsonen brachten Nescafé und Schokolade, Miete und Untermiete, Carepakete und PX-Trips, Lucky Strike und Marlboro steuerfrei, Taxikunden und Tupperware und damit endlich die reuelose Anlehnung an die Sieger,
die sunny side of the Lamboystreet,
Rock n‘ Roll mit Kentucky fried chicken (die freilich etwas später),
ersten Jazz und mit einiger Verzögerung die ersten Joints.
Rock’n Roll und Chicken waren weiß wie Hühnerbrust, Jazz, Blues und Black Beat waren schwarz wie Eierkohlen (schwarz wie Koks konnte man im Lamboy nicht sagen).
Und „Briketts“ blieben „Briketts“.
Trotz PX und sunny Ronney-Chesterfield
Willi Lang hatte im Laufe der letzten zehn Jahre die Amerikanismen bewusst in seinen feuilletonistischen Wortschatz aufgenommen.
Bewusst und mit kultur- und sprachsoziologischen Theorien untermauert.
Die Amerikanismen waren seiner Meinung nach gewachsene Bestandteile der kulturellen Identität dieser Stadt, die mit fast dreißigtausend amerikanischer Soldaten und ihren Angehörigen zu einem Viertel amerikanisch war und das seit fast vierzig Jahren.
Besonders um die Kasernen herum in den Stadtteilen Lamboy-Tümpelgarten, in Wolfgang und Großauheim gab es jede Menge Besatzungskinder. „Mixed Pickels“.
Die Hälfte der Bevölkerung hatte solchermaßen zustande gekommene Verwandtschaft in den Staaten.
Zu Tausenden waren sie in der Nachkriegshungerzeit in die USA ausgewandert.
Eigenartige Wiederholungstaten, dachte Tally.
In fast gleichmäßigen Abständen von 50 und hundert Jahren.
Halbe Dörfer des Hanauer Umlandes verschwanden um 1780 als verkauftes Kanonenfutter in der britischen Kolonialarmee und blieben drüben, tot oder lebendig. Fünfzig Jahre später trieb der Hunger ganze Regionen über den Teich, Kriminelle und Kriminalisierte, gefolgt von Deserteuren und Demokraten, republikanischen Linken, gescheiterten Revolutionären.
Und hundert Jahre später.
Wieder Hungernde, wieder Kriminelle, und diesmal nicht wie kaum zehn Jahre zuvor zur Emigration gezwungene Naziopfer sondern abgedankte Herrenmenschen, Kriegsverbrecher, stramme Rechte, mit Blut und geraubtem Gut und Boden behaftete.
Welch ein Gebräu, das dort drüben auf ebenfalls geraubtem Land die Grundsuppe der Mickey-Mouse- und McDonald-Kultur bildete.
Tally erlag widerstrebend der Faszination dieser offenbaren Auswüchse und Geschwüre entwurzelter europäischer Desperados und Deportierter,
Drückeberger und Draufgänger.
Wie eine Springflut überschwemmte diese Suppe jetzt Europa,
das sie einst ausgeschüttet hatte mit dem Marschbefehl:
Macht euch die Erde untertan
- egal ob rot, ob gelb, ob braun oder schwarz.
Jetzt kam das Echo zurück.
Bereinigt von allen regionalen, religiösen, nationalen Schnörkeln, Zwischentönen, ideologischen Verzierungen.
Der gute alte Weihnachtsmann zum Santa Claus verballhornt ritt auf einer zum Rosinenbomber getunten Cocacolaflasche über frierende verschneite Kleinstädte.
Die Macht der Liebe kam wieder als die Macht des Dollars und traf gewaltig ins innerlichste deutsche Mark.
In die verinnerlichte Deutsche Mark.
Die Freude, schöner Götterbote echote höhnisch Lucky Strike in God we trust der Dollarnote. Amerikanisch verschnitten und millionenfach Rank-Xerox-kopiert schlug die deutsche Romantik auf ihren Ursprung ein.
Beethoven wird unvollendet eingespeist in Fish und Chips, Wagner kehrt tiefgefroren als Pizza in deutsche Kühltruhen zurück.
Waren schon Phillipsruh und Wilhelmsbad verschnörkelt verpackter Machtrausch, so wurden sie jetzt mit Neuschwanstein zusammen zur dekorierten Dekoration romantischer Verschleierung.
Kulisse zur Kulisse der Kulisse.
Nimm zwei im Doppelpack zum Sonderpreis in Nostalgieversion mit Quarztriebwerk.
Selbst durch die sechste Verpackungslage mit Schleifen und Zertifikaten grinste der Zweck unverhüllt das Opfer an.
The Goldsmithhouse is so fantastic romantic.
Es gab Hunderte von Gründen, den Einfluss des Amerikanischen auf die Sprache und die Kultur der Stadt, der gesamten Region zu bejahen.
Für Tally allerdings galten zumindest gleichgewichtig noch andere Gründe:
er vollzog mit seiner erst un- und dann bewussten Sprachwende eine Absetzbewegung gegen seine Vergangenheit, gegen alte Freunde und ehemalige Mitkämpfer vom linken Flügel, mit denen er gemeinsam gegen den politisch-ökonomisch-kulturellen Yankee-Imperialismus gestritten hatte.
Keine zehn Jahre war das her.
Tallys Sprachwechsel vollzog sich kaum bemerkbar.
Die von der amerikanischen Anti-Vietnamkriegsbewegung entlehnten Vokabeln der Antiautoritären Revolte ermöglichten ein leises Umschwenken:
Sit-ins, Teach-ins, Happenings, Peace now, Black-Power, Soulbrother…..
„Dont bother the joint my friend… “
Wie oft hatte sich der Grass-Qualm, Piece for Peace, im Hinterzimmer des Gasthauses „Zum Goldenen Herz“ oder im Club Voltaire mit gut deutschem Bierdunst vermischt.
während nebenan im Hinterzimmer die wackeren Spartacisten mit „C“ die Weltrevolution planten.
Good times…
Wenn sein Freund Schwinn alias Schwamm sich mit Binding vom Fass vollsaugte und zur Polizeistunde die Internationale zum Besten gab, mit geballter Faust den ins befreite Gebiet eindringenden Hipos sein entschlossenes „We shall overcome“ entgegenlallte.
Very good times..
Unübertrefflich Wilhelms Heldentenorwirtsstimme, die wechselweise „Umsatz! Umsatz!“ oder unvergessliche Marschlieder aus seiner freibierumspülten SA-Sturm- und Drangzeit durch die Wirtschaft schmetterte.
Wenn Wilhelm schunkelnd und schenkelklatschend bei der Sperrstunde Widerstand gegen die Staatsgewalt leistete, röhrte er meist „Keiner, ja keiner schiebt uns weg.“ im Viervierteltakt, dann kochte der Saal. Und die öffentlichen Hände waren verunsichert ob des Notenwechsels.
Auf den amerikanischen Text wollte er sich nicht einlassen.
„Das ist die Sprache der Besatzer!“
Den Vorschlag, das „Goldene Herz“ in „A Heart of Gold“ umzubenennen, lehnte Wilhelm aus gleichen Gründen kategorisch ab.
Dabei hätte das vielleicht viel mehr „Umsatz“ gebracht.
Good times… Best times!
Selbst die strammsten Protest-Songs , musikalisch und literarisch so wertvoll wie männergesangsgepflegtes deutsches Volksliedgut, klangen auf amerikanisch noch erträglicher als auf deutsch, wenn sie von stanilismusverdächtigen Schreibern wie Stütz, Wader, Süverkrüp und Co. in gewerkschaftlich abgesegnete Worthülsen übersetzt und genölt wurden.
In Deutschland ging alles
entweder rechts, zwo, drei, vier
oder links, zwo, drei, vier.
Nicht nur, aber auch im Viervierteltakt trafen sich die Pole. Daran hatte Eisler nichts ändern können.
Und auch der Beat bekam bei seiner Arisierung diesen deutschen Schlag.
Heino war nur was für rechte Mumien.
Die Animals, die Doors, die Stones oder Jimmy Hendrix auf Deutsch beim ersten Mai?
Allein der Gedanke verursachte bei Tally erhebliche Zahnschmerzen.
Eine Flatsch-Version auf hessisch hätte er sich noch vorstellen können, eine auf Kölsch mit BAP auch.
Das Problem war nur die geringe Verbreitung der Dialekte, Deutschland war und blieb kleinkariert, auch sprachlich.
Der schwarz-amerikanische Slang wurde überall auf diesem riesigen Halbkontinent verstanden, das verwandte Kreolisch in der gesamten Karibik.
Brother klang nicht so martialisch wie Genosse.
Nicht so gewerkschaftsbürokratisch wie Kollege. Und mit dem Kumpel auf den Lippen logen sich die DGB-geprüften, DKP-geschulten Musikfunktionäre volkstümelnd an die Prolos heran.
- Amerikanisch war authentischer,
- klang zumindest so.
Aber Tally wußte auch, wo der Pferdefuß herausschaute.
Brother konnte sich jeder nennen, wenn er feeling zeigte.
Das eröffnete fließende Übergänge.
Zwei schwarze Generäle,
drei farbige Senatoren,
ein Oberbürgermeister in gelb oder braun,
GM-gesponsorte schwarze Spitzensportler
und James Brown als Befriedungsmarionette
gegen die Aufstände in den schwarzen Ghettos.
Vor einem Vierteljahrhundert fast eine Revolution.
Und heute?
Ein Bimbo kommandierte die US-Streitkräfte.
(Manchmal rutschte auch Tally der Hanauer Alltagsrassismus über die Lippen.)
Da war nichts mehr von Klassenzugehörigkeit zu hören,
höchstens als drittrangiges Merkmal eines Bothers, einer Sister. Und Martin Luther Kings: „I had a dream“, sagte auch nicht so präzise, wohin sein Traum zielte.
Ein schwarzer Präsident in Washington war genauso denkbar wie ein farbiger Aufsichtsratsvorsitzender bei Dow Chemical.
„Times they are a changing..“
Auch damit konnte der Robert Bob Zimmermann-Dylan mehr gemeint haben, als man damals darunter verstand.
In Hanau gab es eine Reihe von prominenten hugenottischen Fabrikanten, hohen Würdenträgern, zumindest einige Jahrhunderte, nachdem die Hanauer Grafen sie in die Stadt geholt hatten. Zugegeben, sie waren keine ins Land geholten und geraubten Sklaven, die als Tiere gehandelt wurden.
Sie waren gefragte Handwerker, Kaufleute, Fabrikanten, Wissenschaftler, des Schreibens und Lesens kundig, wenn auch nicht des Deutschen.
Sie hatten keine exotische Hautfarbe und sie hatten vergleichsweise schnell die gleichen Rechte wie die Eingeborenen.
Und ihre Namen signalisierten Hochkultur: Savigny, Pelletier, Lafontaine, Boussonville, das Hanauer Telefonbuch war voll davon.
Ähnlich und ganz anders war es bei den Polen. Stankowski, Grabowski, Skovsky, Borowsky, Jankowski, Bednarz oder Bednarsky, egal ob mit Y oder mit I.
Die hängengebliebenen Zwangsarbeiter bei Heraeus und Dunlop
und ihr Kauderwelsch…..
„Hängengebliebene Zwangsarbeiter“ welch geniale Doppeldeutigkeit.
Der Bus fuhr an und gab Tally den Ruck, den er sich längst selbst hätte geben müssen. Er durfte nicht mit leeren Händen bei der Redaktionkonferenz erscheinen.
Jetzt stoppte der Bus schon wieder.
Draußen nahm das Gewitter sintflutartige Ausmaße an.
Der Sturm hatte sich gelegt.
Dafür schüttete es wie aus Badewannen.
Von der Hutkrempe tropfte lauwarmes Regenwasser in den heruntergerutschten Ärmel seines Lodenmantels.
Tally schloss die Lüftungsklappe, was ihm wieder einen dankbaren Blick seiner Nachbarin einbrachte.
Willi Lang nutzte die erneute Wartezeit, um sich auf die Sitzung vorzubereiten.
Er hatte seinen Feuilettonbeitrag für die Samstagsausgabe schon seit Wochen auf Diskette und mehrmals geschoben, von sich aus, da er unsicher war, ob er ihn bringen konnte.
Wieder ein kleiner Racheakt und wieder knapp an der Toleranzschwelle des Anzeigers.
„Der Antiamerikanismus der ‚Linken‘ trägt rassistisch-nationalistische Züge“.
Eigentlich eine Nummer zu groß für den Hanauer, aber Tally mußte ihn hier veröffentlichen. Es ging ihm um die lokalen Bezüge, es ging ihm nicht um „die Linken“ sondern um die Hanauer Linke.
Es gab noch offene Rechnungen.
Er wollte mit einem Verweis auf den ‚Antizionismus‘ im linken Spektrum, die Verbindungen der Roten Armee Fraktion zu arabischen Staaten und deren frühe Beziehungen zu geflüchteten Nazigrößen aufdecken und den Bogen zu den aktuellen Aktionen der Linken und Autonomen gegen die US-Army schaffen.
Der volkstümliche Nachkriegs-Antiamerikanismus und Rassismus bot den Nährboden für rechtsradikale „Nationale Befreiungs“-Parolen und der Ruf „Ami go home!“ war alles andere als ein Empörungsschrei geknebelter Demokraten.
Es war der Ruf übriggebliebener Nazis und deutschnationaler Elemente, der sich in den fünfziger Jahren mit den nationalen Vereinigungstönen der stalinistisch beherrschten Organisationen in Hanau vermischte.
Tally war sich darüber im Klaren, daß er mit diesem Beitrag im Hanauer Anzeiger auf des Messers Schneide reiten würde.
Der Seniorchef des Verlages gehörte zu den Kriegsgewinnlern.
Die evangelische Waisenhausstiftung hatte den Waisenhaus-Anzeiger-Verlag, die dazugehörige Akzidenzdruckerei und die gesamte Liegenschaft ihrem in die NSDAP eingetretenen Geschäftsführer zu einem symbolischen Preis notverkauft, um die Substanz der Stiftung und die Zeitung vor dem Zugriff der Nazis zu retten.
Nach dem Krieg verweigerte der Herr dann die Rückgabe.
Und wartete nicht all zu lange, bis ihm die Militärregierung die Lizenz für den Anzeiger erteilte.
Der Mitläufer sollte wieder mitlaufen. Die erste harte Anti-Nazi-Truppe der Amis war abgezogen worden. Dwight D: Eisenhauer hatte Trumans Aussage nach der Konferenz von Malta sehr gut verstanden: „Wir haben das falsche Schwein geschlachtet!“. Antifaschismus war passé – Antikommunismus war angesagt. So passte auch der Anzeiger-Senior als schnell geläuterter Gelegenheits-Nazi bestens in den Aufbau der neuen Front. Die protestantischen inneren Widerständler in der Waisenhausstiftung waren keine Garanten für harte Schläge gegen Kommunisten.
Bevor er zum Anzeiger ging, hatte Willi Lang unter Pseudonym diese Story schon mal der Offenbach-Post, dem Main-Echo und der Frankfurter Rundschau angeboten. Doch das war damals wie mit den Kunstfehlern bei Ärzten oder der juristischen Verfolgung von Nazi-Juristen durch bundesdeutsche Gerichte. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Tally mußte bei solch sensiblen Themen sehr präzise arbeiten, um die Befindlichkeit in der oberen Verlagsetage nicht anzukratzen.
Er durfte auch nicht die Volksseele im Mark treffen, nicht die schnell entnazifizierte Hanauer Geschäftswelt, das haute sonst ins Verlagskontor.
Der Anzeigenmarkt war hart umkämpft.
Besonders musste und wollte er den Eindruck vermeiden als arbeite er der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und anderen kryptokommunistischen Gruppierungen in die Hände. Doch sein plakativer Antistalinismus war stadtbekannt. Seine diffuse Distanz zum betonierten Funktionärskern der Alt-SPD hatte er von 68 bis in die 80er hinübergerettet, was sich jetzt als aufstiegsfördernd erwies. Denn auch alle historisch gewachsenen Volksfrontseilschaften konnten den Vormarsch der Schwarzen nicht aufhalten.
Die linken Sekten waren chancenlos, wie die Anarchisten oder die, die sich im Revoluzzer-Streetfighter-Outfit dafür hielten, ohne einen blassen Dunst einer Ahnung von anarchistischer Theorie und Praxis zu haben.. Die meinten halt die Anarchie käme gerade so aus dem Chaos ihrer WG-Küchen oder aus dem Bauch. Auf selbigem würden sie früher oder später auch landen. Bis auf diejenigen, die noch rechtzeitig den bürgerlichen Heimathafen wieder ansteuern konnten.
Und die Grünen, diese selbsternannten Alternativen. Eine Mischung aus altgewordenen Naiven und machtgeilen Restbeständen aller 68er Strömungen, die zum letzten Gefecht um Posten und Pöstchen angetreten waren. Und dann die Spätschalter, die Arbeitstiere, die vereinigten Kräfte aus dem VDI-ML, dem Verband Deutscher Ingenieure – Marxisten-Leninisten, die bereits 1968 wie üblich zu spät kamen und heute dementsprechend die grüne Nachhut bildeten und nibelungentreue schworen, wenn’s vorne bereits bröckelte. Geisteswissenschaftler wie er, gehörten schon immer zur Vorhut, genau so, wie sie als Erste auch wieder vom Zug absprangen, wenn’s brenzlig wurde. – Die Mobilgarde der Revolution –und der Konterrevolution.
Bei diesen Gedanken und Begriffen, Worten rollte sich seine Zunge automatisch zum Rodenbacher „R“, zum „R“ der Wetterau, wo er als Kulturhistoriker die „Rrourerriewerobbmaschien“, dieses frühindustrielle Rübenerntegerät, als Synonym einerseits für den Sozialisten fressenden Bismarckschen Staatsapparat aber auch für den sozialdemokratischen Parteiapparat erforscht hatte.
Die Technische Intelligenz war spät gekommen, doch sie entwickelte im Gegensatz zu den Geisteswissenschaftlern bei den Grünen gesellschaftspolitische Visionen – Utopien – reale Utopien. Dass sie gerade dabei waren diese an und für sich genommen herrlichen Utopien auf ein linksliberales Mittelschicht-Mittelstandsförderprogramm zusammen zu kürzen, das konnte die nicht wissen. Diesen Mittel-Klassigen Fachidioten hätte jeder durchschnittliche Psychologiestudent im zehnten Semester auf den Kopf zusagen können, dass sie ihren guten Riecher für kommende Marktlücken und –Nischen unbewusst und mit bestem Gewissen und politischer Jungfräulichkeit ins Wetterleuchten einer sanften Revolution umdeuteten. Aus diesem blühenden antiautoritären Kindergarten würden sich Siemens/Degussa usw. schon bald bedienen können. Einige wenige würden es schaffen -–vom Solarbastel-Freak zum Solar/Silicium-Bereichsleiter, von der Alternativ-Werkstatt zur Aktiengesellschaft.
Und die erfolgreichen alternativen Neureichen hatten auch gleich noch ihre Rechtfertigungsideologen:
die verwandlungsfähigsten aus den gemeinsamen Kampftagen.
„Man muss das Kapital eben mit dem Geldbeutel schlagen!“,
hatten bekannte K-Gruppenhäuptlinge von sich gegeben.
Oder noch besser von weiter linksaußen:
„Wir hatten vergeblich versucht, die Börsen als Sitz des Bösen hochgehen zu lassen. Jetzt stehen unsere Ideen hoch im Kurs und unsere Aktienkurse gehen hoch. Lasst uns die Börse von innen erobern: Volks-Solarmodule, Volks-Solaraktien,
Wir wollen alles…“
Das galt für Frankfurt.
Hier in Hanau kommt’s erst später.
Doch ganz klein und bescheiden fing es auch hier schon an:
– Wer die Krone nicht kriegt – macht aus Kuba eine Kommanditgesellschaft!
Musste ja so kommen, nachdem die meisten Besucher dieser Hanauer Musik-Kneipe dachten, sie wäre nach dem Gesöff benannt. Und dabei hatte Kuba Libre erheblich mehr mit Revolution zu tun als der Hanauer Kultur-Bazar.
Ein heimliches Grinsen konnte sich Tally angesichts des Anlasses für seine Antiamerikanismus-Artikel nicht verbeißen.
Und eigenartigerweise meinte er auch bei Little und der Verlagsleitung eine Spur von hämischem Feixen zu entdecken.
Das bestätigte ihn bei seinen Thesen zum Antiamerikanismus.
Hier gab es eine verdeckte Verbindung zwischen deutsch-nationalen Honoratioren
und linken Chaoten.
Zwischen dem schwarzen Block auf der rechten
und dem auf der linken Seite.
Die Geschichte war köstlich,
Tally wäre gern dabei gewesen,
vor zehn Jahren hätte er sie sicher noch mitinszeniert:
Bei der Verabschiedung des Standortkommandierenden der US-Army in Hanau
sollten Paradeeinheiten wegen anhaltend schlechten Wetters
statt auf dem Neustädter Markt im Rathausfoyer exerzieren.
Akrobatik mit aufgepflanzten Bajonetten.
Unter die versammelte Provinz-Hautevolee hatten sich einige Autonome
aus der Anarcho-Szene gemischt und getrocknete Erbsen gestreut.
Nachdem die ersten Vertreter des US-Imperialismus über die Erbsen gestolpert
und mit ihren Menschenfleischspießen Richtung Publikum geschliddert waren,
wurde die Feier abgeblasen.
Die Frankfurter Rundschau meldete mit kaum versteckter Sympathie:
„Erbsen bedrohen die Sicherheit der US-Streitkräfte“.
und in den linken Postillen erschienen prustende Überschriften.
„Wie der US-Imperialismus im Hanauer Erbsenkrieg gestürzt wurde“
Geschichten, wie sie das Leben selten so satt und drall schrieb.
Als Tally um zwanzig nach fünf mit triefendem Hut das Verlagsgebäude in der Hammerstraße betrat, hatten sich die Gewitterwolken bereits aufgelöst.
Zumindest die am Himmel.
Alles über Tora Bora>/ Ora et Labora/ Urbi et Orbi/ Trabi et Gorbi
Datum: Dienstag, 12. Februar 2002 23:48
Betreff: Ihr Bildbericht betr. Didi Thurau vom 08.02.02 (ute)
(einscannen: FR-Bild ‚planiertes Thurau-Mietshaus’)
Sehr geehrte Damen und Herren
von der FR-Lokalredaktion,
ACHTUNG!!!!!!
Dies ist KEIN Leserbrief, wohl aber der Brief eines Lesers.
Sie berichten, dass die Stadt Maintal nach ihrer ersatzvorgenommenen
Umgestaltung des Thurauschen Anwesens „bis dato nichts von ihm gehört“
habe.
Auch Ihnen gegenüber hat sich Didi Thurau offenbar nicht geäußert.
Die folgenden Meldungen können dieses Verhalten des Rad- und
Disco-Matadors,
des Immobilienmaklers und Stadtplaners Dietrich Thurau vollständig
erklären.
In Ermanglung der e-mailadresse der Stadt Maintal möchte ich Sie bitten,
diese Maildungenen an Frau Bürgermeisterin Diehl sowie an den zuständigen
ersten Stadtrat Herrn Günther Wassermann weiterzuleiten.
Mit Dank im Voraus und freundlichen Grüßen
Hartmut Barth-Engelbart
HIer folgen jetzt die Agentur(Nach-)meldungen, Pressemitteilungen etc.:
—–Ursprüngliche Nachricht—–
Von: Barth-Engelbart Datum: Dienstag, 5. Februar 2002 08:06
Betreff: Klinke und Thurau eröffnen ToraBora Disco am Henningerturm
Schade dass Sie diese Nach-Meldung erst jetzt erhalten:
Dietrich „Didi“ Thurau, den Klinke zur Beruhigung der Frankfurter
mit in seine ‚ora et labora‘ Eventholding holte, wollte den Klinkeschen
Abtanzkeller zunächst Didi-Disco und nach erster Ablehnung dann unbedingt Thurau Bureau nennen. „Rund um den HENNINGERTURM“ sei zwar nicht die Tour de France, so der Ex-Radprofi, aber am Ort seiner größten Triumpfe (nach seinem Scheitern als Städteplaner und dem Hausverbot bei „Dorian Gray“) solle „jeder meinen Namen lesen bevor er in den Keller geht“.
Die Benennung des Underground Tanzpalsstes zu Ehren unseres Außenministers wurde in der ora et labora-Planungs-Crew mehrheitlich als einseitige Wahlhilfe abgelehnt .
Darüber hinaus klänge der Name eher nach Fischer-Diskau und spräche somit die falsche Zielgruppe an.
Einer war allerdings vom durchgefallenen Namen begeistert: Heinz Schenk.
Er leitet auf Klinkes Wunsch eine Reihe von öffentlichen
Mediations-Arbeitsessen zur Umgestaltung des Henningerturmes, die der Hessische Rundfunk als „Stadtgespräch“ unter Co-Moderator Uwe Günzler übertragen wird. Zeitgleich soll Didi Thurau wahlweise mit Petra oder Claudia Roth auf der Querstange seine Triumpfrunden um den Henningerturm drehen, um am Ziel die symbolische Sprengung auszulösen. Die von ora et labora im Auftrage Klinkes konsultierten Psychologen führten in einer uns vorliegenden bisher geheimgehaltenen Stellungnahme aus, durch diesen Akt sei Thuraus manischer Zwang zur Zerstörung von Mietwohnungen schlagartig zu heilen.
Die FRAPORT dementiert derweil energisch die hartnäckig kursierenden Gerüchte, sie stecke hinter den Abriss- und Sprengungsplänen wegen der Optimierung der Süd-Variante. FRAPORT-Bender: „da müssten wir ja auch noch den Sonnenhügel zur Bungalow-Siedlung umgestalten. Hinter diesen lancierten Falschmeldungen stecken kriminelle Ausbaugegner, die mit der Angst der Menschen in Frankfurt ihr schmutziges Geschäft machen!“
Harte aber notwendige Worte.
Unklar bleibt indes, ob es Johnny Cash-Klinke nun doch gelungen ist Harry Belafonte für das Opening zu gewinnen. Als gesichert gilt die Zusage des Alt-Super-All-Stars, dass zumindest ein Double die aktualisierte Version seines wohl bekanntesten Liedes „Hey Mister Tallybahn….“ bei der Einweihung der Mega-Rutsche im Tora Bora singen darf.
NÄCHSTE MELDUNG
Am 01.02.2002 um 22:39:42 Uhr überschrieb unser Regional-Korrespondent ‚Südliche Wetterau‘ die ihm irrtümlicher Weise und mit über einem Monat Verspätung zugestellte Einladung der Wetterauer GRÜNEN
Nato-Oliv-Bündnis-Grüner Aschermittwoch:
Baisisgedanken zum Nato-Bündnis-Grünen Neujahrsabendmahlsempfang in der
Speckgürtel-Provinz um Eurofurt
(Auszug aus dem Einladungstext im Wortlaut)
„Wir hoffen, dass möglichst alle zu dieser rituellen Speisung erscheinen
und niemand aus unserem Kreise zwecks friedenstiftender Maßnahmen vor Kuwait oder am Horn von Afrika herumdümpeln muss, um dort, wie Vorbeter Ludger Volmer und Frau Antje es fordern, als grüne(r) Pazifist(in) gründlich umzudenken.
Alle die es nicht tun, werden noch vor einsetzendem verschärften
Lagerwahlkampf vom Herrn Staatssekretär eigenhändig standrechtlich
umgedacht oder von der als Woityla-Nachfolgerin vorgeschlagenen Oberpriesterin im Reichshauptstadttempel zur Umdenkerziehung auf die rechte Menschen-Fischer-Linie nach Guantanamo verbannt. Bei der Überfahrt müssen die Umdenk-Zöglinge das beliebte Umerziehungslied singen: „Wir werden umerzogen“ oder die bekanntere spanische Version: „Guantanamera … “ Wolf Biermann wird den Transport und den Gesang mit seiner Gitarre begleiten.“
Dementiert haben die Grünen im Römer, dass sie das bislang noch
leerstehende Henniger-Bierkeller-Labyrinth am Fuße des gleichnamigen Frankfurter Turmes für die nächsten Monate angemietet hätten, um eventuelle Abweichler und Aufweichler der robustgrünen Bundeswehr- und -tags-Mandate durch Internierung aus dem Wahlkampfverkehr zu ziehen.
Mit einhelliger Empörung haben die Frankfurter Grünen auf Verlautbarungen aus dem Hause Ditfurth reagiert, die besagen, hinter dem Internierungsplan stecke auch der Entertainer und Chef des Varietés ‚Tigerpalast‘, Johnnny Klinke, der auf diesem Wege versuche, den Plan seiner ‚Tora-Bora‘- Mega-Event-Disco in dem gigantischen Bunkersystem am Sachenhäuser Berg zu realisieren.
SIEHE DAZU AUCH DIE NÄCHSTE MELDUNG
Fischer-Friend Johnny-Klinke expandiert:
Von ‚Babylon‘ nach ‚Tora-Bora‘
Johnny Klinke, das alter ego von Joschka Fischer, plant jetzt den aus den
Nähten platzenden nordmainischen Varieté-Zirkus ‚Tigerpalast‘ in
Frankfurt -Süd-Sachsenhausen zu erweitern. Am Fuße des im City-Logo
ausgedienten ehemaligen Wahrzeichens der Finanzmetropole, am Fuße des Henningerturmes hat Klinke sich über Strohmänner in die Bierkatakomben der bankrotten Henninger-Brauerei eingekauft. In dem schon lange nicht mehr als Binding-Lager benötigten mehrere Kilometer langen Hopfen&Malz-Tunnelsystem will er eine Mega-Multi-Disco unter dem Namen ‚Tora-Bora‘ etablieren.
Eine Reihe von Super-Gau-Gags zur Einweihung sind geplant: Alternativ zu Treppe und Hochgewschwindigkeits-Aufzug, lassen sich die tiefsten Keller (bei über 70 Meter Höhenunterschied) über eine 300Meter lange Riesenrutsche erreichen: der Arbeitstitel dieses noch nicht begonnenen Projektes lautet „Tallybahn“, was letzlich wohl auch der etwas
glitschige Klarname werden wird. „Na ja, über Geschmack lässt sich lange streiten.“ und weiter:
„Je mehr hier bergab gehen um so mehr gehts bergauf“, so Klinke wörtlich gegenüber der Presse.
Nach heftigen Auseinandersetzungen in der Planungsgruppe der Eventholding „ora & labora“ scheint sich eine gemäßigte Fraktion durchgesetzt zu haben. Gerüchteweise sind die ursprünglichen Opening-Event-Pläne durchgesickert:
Sie sahen vor, den streng renovierungsbedürftigen Hennigerturm gegen den Widerstand der hessischen Denkmalschützer zwei Tage vor Eröffnung der Tora-Bora-Disco nach dem Vorbild aus „Mission impossible“ PR-wirksam zu sprengen.
Mehrere Vereine zur Pflege des Frankfurter Brauchtums hatten bereits breite Protestmaßnahmen gegen den Abriss angekündigt. Da Klinke seinen ehemaligen Lieblingsplan – Umwandlung des Henningerturmes in ein erlebnisgastronomisches Zentrum namens „Babylon“ – breits vor Jahren aufgegeben hatte, waren die damals schon aufbrausenden Proteste vorübergehend abgeklungen. Nun musste der Varieté-Chef erneut die Gemüter beruhigen. Die jetzt durch Klinke persönlich mitabgespeckten Eventpläne sehen eine gigantische Videoprojektion vor, bei der unter Einsatz von Laserlichtkanonen die un- und überfallartige Sprengung dieses Wahrzeichens des alten Nachkriegs- und Wirtschaftswunder-Frankfurts absolut realitätsnah vorgetäuscht werden soll.
„Verpackungen sind langweilig, Christo ist mega-out. Die Menschen in den Metropolen brauchen solche Sprengungen mit Giga-Watt als Kick“, O-Ton Klinke.
Sicherheitshalber finanziert der Investor und ehemalige Street-Starfighter der Fischer’schen Sponti-Putztruppe eine komplette Sanitäts-Truppe zur Rettung eventueller Herzinfarkt-Opfer unter den Frankfurter Senioren. Die könnten -so die Warnungen einiger Skeptiker- das Klinkesche Super-Gau-di-Spektakel für einen Bin Laden-Angriff auf die Europäische Finanzmetropole halten.
Jüngstes Dementi aus der Tora-Bora-Planungs-Crew: unzutreffend sei, dass alle Gäste, die das bombastische Opening-End noch gehfähig überstehen mit einem Gratis-Cuba-Libre verabschiedet würden.
((Ebenfalls dementiert wurde vom fernen Baunatal aus die Nachricht, dass die Volkswagen AG ihren Werbefeldzug in Griechenland und der gesamten Adria unter dem Motto : Thora Bora ! wegen der Vorgänge in Frankfurt abgeblasen hätte. („Thora Bora“ ist Griechisch und heißt „Jetzt sofort Bora“) Auch die Produktionseinstellung beim VW-Modell Bora hätte nicht das Geringste mit den jüngsten Ereignissen zu tun – auch nicht damit, dass der Name ‚Bora’ wegen seiner jugoslawischen Herkunft mittlerweile geschäftsschädigend sei. Tatsächlich habe die verantwortliche Agentur der Konzernspitze geraten, den Namen deshalb zu ändern, weil der ex-jugoslawische Fallwind ‚Bora’ in der gesamten Adria wegen seines heimtückischen Charakters anders als z.B. Passat oder Scirocco ein berechtigtes Negativimage habe.))
Zur neuesten Entwicklung am Sachsenhäuser Berg berichtet unser Korrespondent in der Montagsausgabe (04.02.02) des ‚Frankfurter Info‘, das in der online-Version unter www.frankfurt.org:8080/info abrufbar ist
Schon wieder ein Kreistagsprotokoll eventuell kurz vor der „Wende“ und meinem Ende bei den „linken GRÜNEN“ als die NATO-OLIV wurden
Annias dritter Tod
Erzählung
Annia ist zwar jüdischer Abstammung, was sich anhand der zahllosen Register für gettoisierte Juden in Europa leicht nachweisen lässt, aber sie ist es wie andere friesischer, bajuwarischer, sorbischer, masurischer, maurischer, mecklenburgischer, hugenottischer, waldensischer, rätoromanischer, türkischer, hunnischer (mit dem berühmten blauen Hunnenfleck über dem Steißbein), lettischer, estischer, tatarischer, sämischer, finnischer, sächsischer, gotischer, etruskischer, trakischer, berberischer, armenischer, afghanischer, iranischer, syrisch-aramäischer, kurdischer, jesidischer oder makedonischer Herkunft sind. Wer die Frage stellt, ob die Urahnen aus der Vor- oder der Nachhut stammen, der soll sich die Zeit nehmen, um es herauszufinden. Im Lauf der Geschichte scheint eine solche Unterscheidung jedoch unwesentlich.
Dass wir allesamt aus dem Zweistromland stammen und früher oder später in das nach der Eiszeit immer wirtlicher und fruchtbarer werdende Europa ausgewandert sind,
wusste Annia vor ihrer Beerdigung noch nicht. Genau so wenig wußte sie, dass das Quellgebiet des Ganges genau so gut unser Ursprungsland sein könnte.
Was sie wußte
– aus bitterer Erfahrung – , ist,
daß Europa sich seit beginnender Geschichtsschreibung in einer neuen Eiszeit befindet, die nicht den Naturgewalten sondern dem sogenannten zivilisatorischen Fortschritt des Abendlandes zuzuschreiben ist
und es dabei gründlicher und nachhaltiger planiert,
als es die von Nord nach Süd sich schiebenden Gletscher jemals konnten.
Mit rasanter Geschwindigkeit wird Europa immer kälter, immer heißer und unwirtlicher und seit geraumer Zeit auch unfruchtbarer, weshalb seine Verwüster auch vor Europas Grenzen nicht halt machten und so seit fast 500 Jahren nahezu jeden von ihnen noch nicht besetzten Fleck auf diesem Planeten mit ihrem noch lange nicht letzten Dreck besudelten, rodeten, umpflügten, um- und untergruben, nachhaltig erschütterten und zumindest für Menschen und viele andere Tiere unbewohnbar machten und es weiterhin tun. Selbst vor den letzten Traumwelten und Zufluchtsträumen, den letzten geträumten Fluchtpunkten aus diesem hausgemachten irdischen Jammertal schrecken sie nicht zurück.
Die Sterne sind vor ihrem gierigen Zugriff nicht mehr sicher. Schon drohen sie mit ihrer Raffgier unsere Sonne zu verfinstern. Schon greifen sie zur nächsten.
Ihre gigantischen wie lächerlichen Attacken beißen ins All wie Flöhe in den Äquator,
schießen wie Staubpartikel in fremde Galaxien
und trampeln im Mikrokosmos herum wie Elefanten im Porzellanladen. (Die Bilder versagen, den Flöhen, Staubpartikeln, Elefanten und Barbaren ist Abbitte zu leisten, wenn sie als Gleichnisse herhalten müssen.)
Ihr einfältiger Jubel bei jedem fündigen Griff ins Volle wie ins Leere wird nur noch übertroffen von der Grenzenlosigkeit und gleichzeitigen Lächerlichkeit ihrer Barbarei.
Grenzenlos, nur insofern sie nicht wissen, an welcher Stelle des winzigen Makrokosmos und des riesigen Mikrokosmos sie was mit welchen Folgen anrichten.
Ein schwacher Trost, daß sie sich selbst und ihresgleichen in den folgenden Generationen, so es noch welche geben sollte, zugrunde richten.
Denn auch alle, die sich dagegen stemmen, reißen sie mit in das alles überlebende schwarze Loch.
Was nicht einmal so sein muss,
dem schwarzen Loch wird es möglicherweise gar nicht auffallen, welche Kamikazeflüge einige Ionen auf einem Staubpartikel namens Erde unternehmen. Und das große, erlösende Finale ? Alles Trugbild, erwinselte Gnade, das jüngste Gericht ist nur Gerücht und wird ewig auf sich warten lassen. Unsere Hoffnung auf das Ende japst einer Schimäre nach … bis ins letzte Glied ?
Beruhige dich,
Es wird schon nicht so werden und es ist auch jetzt nicht so, wie du es schilderst, würde Annia sagen und ihre Hand auf deine legen.
Sie hasst die Schwarzweißmalerei und lächelt, tanzt und feiert angesichts der in manchen und nicht den schlechtesten Köpfen sich ankündigenden Apokalypse.
Der Golem ist listig und hat viele Seiten.
Mindestens zwei, die wir sehen und spüren.
Leben und Tod,
Gut und Böse,
wobei das eine das andere sein kann und umgekehrt.
Wir selbst sind ein Teil davon, wie die Wellen im Meer.
Wie die Kraft des Wassers und der Luft.
Kein Leben ohne Tod.
Und was ist dann dabei gut, was böse?
Darauf hat sie nicht geantwortet.
Nur jenen Schlauköpfen, die als Propagandisten der menschlich machbaren und gemachten Katastrophen die Schöpfung riskieren und sich selbst zum Golem erklären in welcher Gestalt auch immer, denen hat sie nicht das Wort geredet.
Die ausgestattet mit der Fähigkeit der Reflexion aus kurzsichtigem Eigennutz den anderen bewusst verletzen, quälen und morden. Und sich dabei erheben über die Tiere, die Pflanzen, denen sie ihre mörderischen Absichten unterstellen.
Auch wenn ihre Absichten nicht auf Mord ausgerichtet sind, so sind sie dennoch mörderisch.
Tierisch wütende blutrünstige Barbaren sind nicht die Inkarnation des Guten, aber sie sind liebenswerte Geschöpfe im Vergleich zu den rundumdesinfizierten, vakuumverpackten Hightechkillern in Menschengestalt, die ohne eine Blutspur an den behandschuhten Fingern die gesamte irdische Schöpfung schlachten und nur ein Millionstel Nanogramm davon für ein sattes Leben bräuchten.
Immersatt -nimmersatt.
Sattsein gibt es ohne Hunger nicht.
Auch das haben sie vergessen, überfressen.
Und sich verfangen in ihrer Überheblichkeit.
Sie müssen sich den Hunger künstlich schaffen, um wieder einmal richtig satt zu werden.
Sie müssen immer versuchen nachzuschöpfen, was sie an der Schöpfung zerstört, zerfressen haben.
Und sie scheitern dabei und merken es, wenn überhaupt, dann viel zu spät.
Sei nicht so pessimistisch.
Deine apokalyptischen Gedankenspiele sind auch nur überhebliche Versuche, sich über den Lauf der Dinge zu erheben.
Du sollst sie nicht laufen lassen,
du musst dich dagegen stellen,
du sollst dich dagegen stellen,
aber glaube nicht, daß du der Herr des Verfahrens wärest.
Wenn Annia guter Dinge ist, hat sie dieses faszinierend gleichgültige . schwankende, verletzlich wirkende starke segelnde Urvertrauen, das dich umhüllt wie aufsteigender Abendnebel auf herbstlichen Lichtungen, dich immer wieder gebiert, wie die aus dem Morgennebel steigende Sonne im Frühling.
Er wird es schon richten und er ist weiblich, der Golem hat die Form und das Wesen der Mutter Erde. Sie ist fruchtbar und furchtbar. Sie ist zornig und hat unendliches Erbarmen. Sie ist unmenschlich, so unmenschlich, daß sie alles menschliche auffangen kann.
Das glaube ich nicht.
Die Menschen gehen über die Grenzen der Golem.
Kennst du sie?
Nein!
Gott sei dank ist die Golem unmenschlich.
Menschlichkeit ist der Ausdruck der Hybris der grenzenlosen Überheblichkeit der Menschen, sich über alles zu stellen, über allem zu wähnen, zu machtphantasieren.
Machtwahn.
Machtrausch ?
Das wäre nur für stunden.
Es ist ein Wahn.
Ein Männerwahn.
Herrenmenschen jeglicher Kultur, jeglicher Religion, jeglicher Ideologie.
Frauen sind anders, das weibliche Prinzip, ein Widerspruch in sich, aber lasse es gelten, nur als Gedankenkonstrukt für eine Weile,
Weiber sind anders.
Selbst die Zerrbilder einer Hilde Benjamin sind seit der Kommissarin in einem anderen Licht zu sehen.
Selbst Mao Tse Tungs Frau – sie wurde von den neuen Kaisern zur Prügelfrau gemacht, Winnie Mandela…
Es gibt keine weibliche Geschichtsschreibung und auch keine Schilderungen, wie Frauen so werden konnten, wie sie wurden oder wie es Männern gelang sie so zu schildern und diese Schilderungen für ihre Herrschaft zu instrumentalisieren.
Ereifere dich nicht so.
Es ist gut, Du magst auch recht haben,
Aber du bist naiv und versuchst, in der Achterbahn zu lenken.
wo der Große Wagen längst die von dir übersteuerte Kurve kriegt oder eine ganz andere Richtung nimmt, die du nicht verstehst, die du nicht siehst.
Du willst dich wieder in statischen Konstruktionen fortbewegen.
Natürlich gibt es herrschende und herrische Frauen.
Vorzeigedamen der Herren, Strohpuppen, Strohfrauen.
Auch in den matriarchalischen Gesellschaften gibt es herrschende und herrische Frauen, gibt es Entwicklungen, die ausschlagen, wie die Fieberkurven der Erde über Hunderte von zig Millionen Jahren der Planetengeschichte.
Auf Kalt folgt Heiß, auf Trocken Nass und anders herum.
Die Golem wird es richten.
Dort, wo wir nichts ausrichten können.
Aber wo wir können, dort wo sie uns den Platz gelassen hat, dort müssen wir auch, dort sollen wir auch und dort werden wir auch dagegen handeln, trotz aller oder gerade wegen aller Widerstände.
Da haben die physikalischen Gesetze einen Teil Wahrheit begriffen. Hier liegt die beruhigende Urangst aller Despoten.
Auch derer, die in uns selbst rumoren.
Annia ist erschöpft,
sie redet nur selten so lange und viel und noch seltener so abstrakt.
Sie hat nie so geredet.
Sie wollte mit dir kämpfen, um dich kämpfen, weil sie dich mag, und nicht zusehen möchte, wie du dich verrennst, verzappelst.
Wohl wissend, daß du nicht aufzuhalten bist in deiner Tretmühle.
So wie viele, die sich mit ungeeigneten Mitteln zur falschen Zeit, zu früh oder zu spät aufgelehnt haben.
Oh ja, es war notwendig, es war gut, es hat geholfen, es hat genützt, aber es war vergeblich, und es wäre schlimm gewesen,
sie hätten es nicht so getan.
So denkst du, hätte sie reden können.
hat sie aber nicht.
Möglicherweise trifft Annia die Milliardenschar ihrer Gesamtverwandtschaft irgendwo im Jenseits von Euphrat und Tigris, dort, wo sie sich schon oft in ihren Leben hin gedacht hatte und hinfliehen sah, meist jedoch hingezwungen, hingehetzt.
Im Gegensatz zum größten Teil dieser riesigen Mischpoke hat sie und haben ihre Altvorderen erst viel später als der Rest zu jeweiligen Lebzeiten ihrer ethnisch-kultischen und kulturellen Identität abgeschworen.
Sie ist, so steht es in den Ermittlungsakten, erst 1964 zum christlichen Glauben übergewechselt. Oder war es bereits 1932, als sie bei Lodz ihren späteren Mann kennen lernte und heiraten wollte? Ein Schweizer mit polnischem Namen, der ein Zweigwerk von Ciba-Geigy in Lodz als kaufmännischer Direktionsassistent coleitete.
Hannia ist christlich beerdigt worden. Oder wurden ihre Ururururururgroßeltern schon zum christlichen Glauben gezwungen, wie damals deine Urururururururururururururururururgroßeltern?
Sie jedenfalls hat das Martyrium nicht weiter ertragen wollen, als Jüdin erkannt und auch noch nach dem Tod gettoisiert zu werden.
Ihr Sohn besuchte nach ihrer Flucht aus Israel ein christliches Internat.
Prophylaxe.
Annia wird christlich beerdigt.
Eigentlich wollte Annia nach der jüdische Zeremonie begraben werden.
Sie hatte sich an Main und Kinzig die jüdischen Friedhöfe angesehen, die das Tausendjährige Reich überlebt und die Naziverwüstungen der letzten Jahre einigermaßen unbeschädigt überstanden hatten.
Der Hanauer Judenfriedhof zwischen Stadtkrankenhaus und Jahnstraße (Jahn, dieser Judenhasser, Franzosenfresser und konstitutionelle Monarchist, warum der wohl noch heute so gefeiert wird?), der Langenselbolder Judenfriedhof an der Gründau, der Gelnhäuser Judenfriedhof am Escher, wo früher Hexen und Juden verbrannt wurden.
Dass der Selbolder Friedhof direkt zwischen Rummelplatz, Sportplatz und Mehrzweckhalle in den geschändeten Auwiesen der Gründau liegt, das hatte Annia nicht gestört.
Das ist halt so, mitten im Trubel, im Leben, mitten im Feiern ist der Tod und der ist nicht böse, Trauern und Feiern gehören zusammen. Die Trennung von Diesseits und Jenseits, von Leben und Tod, von Trauern und Feiern, von Lachen und Tränen, Leid und Freude, ist eine Erfindung des päpstlichen Strafregiments, der Lutheraner, der Calvinisten, der Pietisten und auch der Jüdischen „Traditionalisten“, vor denen ich geflohen bin.
Wenn Annia gewusst hätte, daß die idyllische Lage des Langenselbolder Judenfriedhofes jetzt durch ein schönes Sport- und Fitnesscenter ergänzt wurde, sie hätte im Gegensatz zu den trauernden Denkmalschützern nichts dagegen gehabt:
Da pulsiert das Leben, wenn auch auf sonderbare, mir noch nicht zugängliche Weise.
An ihrem Grab versammelte sich eine seltsam gemischte Trauergemeinde: ein frisch aus dem Sonnenstudio kommender Vertreter der jüdischen Gemeinde, ihr Sohn, die schmale Blonde mit randloser Brille, der etwas nervig wirkende elegant gekleidete, graumelierte mit Mondgesicht und Silberrandbrille….
Todesursache: Herzversagen. Keiner der Anwesenden glaubte an eine natürliche Todesursache, bis auf ihren Mann, der will daran glauben. Sie hat sich in ihrem hohen Alter übernommen. Ihr Mann war dagegen, daß sie nach Polen fährt zumal als LKW-Fahrerin.
Zweifel am natürlichen Tod Annias ergaben sich unter anderem aus einem anonymen Brief, der kurz nach der Beerdigung auf Annias Grab gefunden wurde.
Liebe Annia, dieser Brief wird Dich nicht mehr erreichen.
Ich weiß nicht, warum ich ihn schreibe.
aber ich muss ihn schreiben.
So wie ich Dich kennen gelernt habe, so wie Du gelebt hast, so wie du die mörderischsten Stationen in deinem Leben mit eisernem (?) Lebens- und Überlebenswillen gemeistert hast, ohne andere dadurch in den Tod zu treiben, zu schicken, ja gerade indem du anderen das leben gerettet hast.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß du nur einfach so gestorben bist, daß du aufgegeben hast, daß dein großes starkes Herz einfach versagt hat.
Es muss dir etwas zugestoßen sein, das dich umgebracht hat, wenn dich nicht jemand direkt umgebracht hat.
Vielleicht trage ich Mitschuld, Vielleicht auch andere, was mich aber nicht von meiner Schuld und meinen Schuldgefühlen befreit.
Du hast mich durchschaut, hast mir aber dabei keine Schuldgefühle aufgezwungen..
Du hast mich sehen lassen, wie klein ich eigentlich bin.
wie klein wir sind angesichts der von uns nicht lenkbaren Ereignisse in dieser Zeit und in den Zeiten zuvor.
Du hast mich unendlich beschämt, mir gezeigt, daß es auch in tiefster , in allertiefster Not noch die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen, oder wenigstens zu denken und Nein zu handeln.
Vielleicht habe ich dir den Lebenswillen genommen. indem ich dich ausgesaugt, ausgehorcht habe, Dich überladen habe mit meiner Schuld, mit meinen kleinen und großen nicht verarbeiteten Schuldgefühlen.
Ich habe dich als Fundgrube und als Müllabladeplatz gleichermaßen benutzt, obwohl ich wußte, daß du alles andere brauchtest. Du hättest das Paradies gebraucht und verdient. Dein drittes Leben.
Vielleicht war ich es, der dich umgebracht hat, meine Eitelkeit, mein mich in deinem Leben sonnen und der ungeheuere Versuch sich darin zu spiegeln.
Du wolltest nicht mit deinen Erinnerungen an die Öffentlichkeit. Du hast sie mir im langsam gewachsenen und von mir erschlichenen Vertrauen unter den Siegel der Verschwiegenheit erzählt. Nur für Dich und mich.
Ich habe dich gedrängt und ausgefragt. Es war oft ein voyeurhaftes Aushorchen. Ein Fressen, ein in mich hineinstopfen von Tragödien, die mir kein Fernsehen, kein Film, die mir mein Leben, mein Beruf nicht gegeben, ja geboten hat, so geschmäcklerisch habe ich sie ausgekostet und insgeheim auf ihre Verkäuflichkeit geprüft.
Ich habe dich ausgenommen.
Mit welchem Sinn? Unter dem scheinheiligen Vorwand, dein Leben als mahnendes Dokument zu präsentieren, mit dem Hintergedanken, daß einiges von deiner Glorie auf mich herabstrahlt. Dabei ging es nicht um dich und dein Leben und die vielen Millionen, die dein Schicksal teilten oder gerade nicht teilten, nicht teilen konnten..
Ich kann nicht ermessen, was mein Fragen in dir ausgelöst hat.
Du hast wenig davon gezeigt.
Aber ich kann es mir andeutungsweise vorstellen, wenn ich die in Stummheit erstickten und abgehackten Sätze anderer Zeugen des Grauens höre, wenn ich sehe, wie sie ihre Stimmen in trockenen Tränen verlieren.
Liebe Annia, gleichgültig, wer und was dich in den Tod getrieben hat. Mein Anteil daran ist vielleicht klein, aber übergroß und nur schwer zu ertragen. Ich kann dich nicht mehr fragen, was ich tun soll. Du hast mich damit allein gelassen.
Jetzt bin ich an der Reihe. Mit einem kleineren, einem kleinlicheren und engeren Herzen, werde ich versuchen, kleinere Dinge zu tun, aber ich werde sie tun, selbst tun.
Du hast mich in die Selbstverantwortung entlassen. Du bist nicht länger die gesuchte Gegen-Übermutter.
Du hast mich nicht eingefangen mit deinen weiten Armen, du hast mich ausgestoßen. Du hast mich nicht an dein Herz gedrückt, nicht an deinem mütterlichen Busen zerdrückt. Du hast mich abgewiesen und mir gezeigt, daß es gut ist, einen klaren kühlen kopf zu haben, zu gewinnen, nicht durch Wärme korrumpierbar zu sein, sich nicht für drei Briketts zu verkaufen und wenn schon, und es muss oft sein, dann eben mit kalkulierend kühlem Verstand.
Wärme ist schön, wenn sie dich umgibt, dich aber nicht gefangen hält.
Obwohl mir die Tränen die Augen vernebeln und Trauer und Wut den Verstand,
ich werde alles daran setzen, heraus zu finden, wer oder was dir dein drittes Leben nahm.
auch, wenn ich dabei nur mich selbst finde.
Ich habe versucht, dich so hoch zu hängen, daß du unmöglich zu erreichen bist, daß dein Leben gottgleich und damit als Vorbild unerreichbar ist. Unnachlebbar. Ich habe nicht dich und deine Person gesehen,
deine Unzulänglichkeiten, deine Fehler habe ich übersehen, wegzensiert, um mich nicht mit dir vergleichen zu müssen.
Ja, DIE konnte das, so was kann ich als normaler Sterblicher nicht. Ich habe weggesehen, als du getanzt und gesoffen hast und geflirtet. Du hast gefeiert, als um dich herum die Menschen im Dreck lagen und hungerten. Du hast gesungen und gelacht, als Trauermine und Büßerhaltung angesagt war. Du hast auf dem Vulkan getanzt und deinen Peinigern den Mazurka demonstriert und geweint, als alle anderen lachten und soffen und tanzten.
Du hast deine Stärke vergessen, wenn es völlig unangebracht erschien und kühl und entschlossen gehandelt, als alles vor Angst erstarrt war.
Aber das war kein Gesetz, keine Regel. Du hast es getan wie eine Schlafwandlerin und nicht wie eine martialische Heldin.
Du hast es getan, weil du es tun musstest. Du hast geplant und gegen deine Pläne gehandelt. Du warst kein Lehrstück und gerade darum warst du eines.
Und das ist es, was nicht in meinen christlich-deutschen Schädel will. Das ist es, was ich nicht wie einen Katechismus lernen kann, nicht wie mathematische Formeln und ideologische Baugerüste.
Ich könnte es leben, wenn ich es wagen würde zu leben.
Du bist nicht tot. Ich aber – so fürchte ich – werde an deinen von mir gestohlenen Leben sterben.
Ich habe dich aufgesaugt.
Trotzdem ich dich wie eine heilige Schrift behandelt habe,
wie ein Reliquienhändler seine geraubten Märtyrergebeine, trotzdem ist etwas von dir in mich gefahren.
Ich spüre es, während ich diesen Brief schreibe.
Aber stur wie ich bin, und du musst es mir verzeihen oder musst es nicht, du wirst es mir verzeihen oder nicht, ich tue es, ich werde suchen, auch gegen deinen Willen, auch ohne deinen Segen.
Ich werde finden, wer oder was deinem physischen Leben ein Ende gesetzt hat. Und ich habe den Verdacht, daß es viele Tatbeteiligte gibt. Gründe zumindest für Beihilfe zum Mord, zum Schlussstrich, zum Totschweigen, zum Tottreten, zum Totreden gibt es sehr viele für sehr Viele.
Dass staatliche Institutionen sich in die Suche nach deinen Totschlägern, -rednern, -schweigern einschalten, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Für sie ist die Ursache deines physischen Todes klar und darüber hinaus müssten sie ja unendlich viele Untersuchungen nachholen.
Denn außer dir sind unendlich viele Menschen auf ähnliche Weise umgebracht worden. Auch und gerade durch jene, die da suchen müssten und es nicht weit hätten.
Ich mußte mich von dir befreien, weil ich dich nicht aushalten konnte.
Du kanntest meine Lebenslügen, so klein und kleinlich, so lächerlich sie auch waren und sind.
Du bist mir nicht gefährlich geworden, weil du meine Karriere hättest zerstören können.
Du hättest aber mein Leben zerstört.
Du hast meinem Leben eine Wendung gegeben, die ich nicht wollte, du hättest ihm eine Wendung geben können, die mir keine Handlungsfreiheit mehr lässt.
Du hast mich daran gehindert, so weiter zu leben, wie ich es mir eingerichtet hatte, wie ich leben wollte.
Deine Existenz hätte mich gezwungen, alles aufzugeben und angesichts eines Scherbenhaufens noch mal von vorne zu beginnen.
Dazu habe ich nicht den Mut, nicht die Zeit und nicht die Kraft.
Ich hätte nicht einmal gewusst wo vorne ist, ob ich erst wieder geboren werden muss. Dein Weiterleben hätte immer hinter mir gestanden. Jede Bewegung hätte ich durch deine Augen beargwöhnen müssen, jede Äußerung, jede Handlung. Du hast mir gesagt, man müsse zu seinen Fehlern stehen, sie annehmen und in der Erkenntnis der eigenen Fehler ohne Asche auf dem Haupt sein leben ändern, anders handeln. Ich kann es nicht. In allem was ich tue, schwingt meine Geschichte mit, ist davon durchdrungen und du stehst neben mir und bist die Meßlatte, die urteilende Instanz. Und dabei nicht verurteilend, so daß ein sich gegen dich wehren um so schwerer wird.
Dich sterben zu sehen, war befreiend, und leichter als dich umzubringen. Und doch viel schwerer. Denn es bleibt keine klare Entscheidung:
Ich habe dich umgebracht.
Es bleibt das nagende Gefühl:
ich hätte dich umgebracht haben können.
Eigentlich sehne ich mich danach, sagen zu können:
Dich umzubringen war befreiend,
bevor du als Übermutter dich über mich beugst und mich erstickst.
Du warst nicht meine Übermutter, aber ich habe mir aus dir eine gemacht.
Mit dem Vater, mit Vätern abzurechnen ist leicht.
Ihre Verbrechen sind gut getarnt versteckt aber leicht zu entdecken.
Aber die der Mütter?
Mütter sind Tabu.
Es ist viel schwieriger, sich von der Mutter und ihrem Schatten zu befreien.
Sie steht in Übergröße und nicht greifbar, unangreifbar über mir und dich traf das Unglück, daß ich dich zur Übermutter gemacht habe.
Ich weiß, daß dein Tod auch mein Ende bedeutet.
Doch lieber ein Ende mit Grauen als ein Grauen ohne Ende.
Du hättest mich sonst schleichend, langsam zerstört.
Ich habe geschrieben, daß kein Staatsanwalt ermitteln wird. Von sich aus nicht.
Erst, wenn sie meinen Brief gefunden haben, werden sie ermitteln. Ich warte darauf, ich bin darauf gefasst, ich hoffe, daß sie nach mir suchen.
Sie werden mich finden und dich leidenschaftslos, gleichgültig rächen und es werden nicht die sein, die dich lieben, die dein Leben und dein Leiden kennen. Es wird ein ganz banaler Akt werden.
Ich werde, wenn ich Glück habe, wegen Totschlags oder Ähnlichem eine Strafe erhalten, in die Psychiatrie eingeliefert und dann ist Schluss, wenn ich ihnen nicht zuvorkomme.
Sie werden mich am Fließband abhandeln, wie jeden anderen gemeinen Totschläger.
Es wird kein Aufschrei durch die Presse gehen. Ich habe dich ja nicht gefoltert, verstümmelt, erstochen, erschlagen, erschossen, erhängt. Ich habe dich nur in den Tod getrieben.
Hannias
drittes
Lebensende
Erzählung aus dem
Prosa-Zyklus Grenzgänger
Hannia ist zwar jüdischer Abstammung, was sich anhand der zahllosen Register für gettoisierte Juden in Europa leicht nachweisen lässt, aber sie ist es wie andere friesi-scher, bajuwarischer, sorbischer, masurischer, maurischer, mecklenburgischer, hugenottischer, waldensischer, räto-romanischer, türkischer, hunnischer (mit dem berühmten blauen Hunnenfleck über dem Steißbein), lettischer, esti-scher, tatarischer, sämischer, finnischer, sächsischer, go-tischer, etruskischer, trakischer, berberischer, armeni-scher, afghanischer, iranischer, syrisch-aramäischer, kur-discher, jesidischer oder makedonischer Herkunft sind. Wer die Frage stellt, ob die Urahnen aus der Vor- oder der Nachhut stammen, der soll sich die Zeit nehmen, um es herauszufinden. Im Lauf der Geschichte scheint eine sol-che Unterscheidung jedoch unwesentlich. Dass wir alle-samt aus dem Zweistromland stammen und früher oder später in das nach der Eiszeit immer wirtlicher und frucht-barer werdende Europa ausgewandert sind, wusste Han-nia vor ihrer Beerdigung noch nicht. Genau so wenig wußte sie, dass das Quellgebiet des Ganges genau so gut unser Ursprungsland sein könnte. Was sie wußte
-aus bitterer Erfahrung-, ist, daß Europa sich seit begin-nender Geschichtsschreibung in einer neuen Eiszeit be-findet, die nicht den Naturgewalten sondern dem sogenan-nten zivilisatorischen Fortschritt des Abendlandes zuzu-schreiben ist und es dabei gründlicher und nachhaltiger planiert, als es die von Nord nach Süd sich schiebenden Gletscher jemals konnten. Mit rasanter Geschwindigkeit wird Europa immer kälter, immer heißer und unwirtlicher und seit geraumer Zeit auch unfruchtbarer, weshalb seine Verwüster auch vor Europas Grenzen nicht halt machten und so seit fast 500 Jahren nahezu jeden von ihnen noch nicht besetzten Fleck auf diesem Planeten mit ihrem noch lange nicht letzten Dreck besudelten, rodeten, umpflügten, um- und untergruben, nachhaltig erschütterten und zumin-dest für Menschen und viele andere Tiere unbewohnbar machten und es weiterhin tun. Selbst vor den letzten Traumwelten und Zufluchtsträumen, den letzten geträum-ten Fluchtpunkten aus diesem hausgemachten irdischen Jammertal schrecken sie nicht zurück. Die Sterne sind vor ihrem gierigen Zugriff nicht mehr sicher. Schon drohen sie mit ihrer Raffgier unsere Sonne zu verfinstern. Schon grei-fen sie zur nächsten. Ihre gigantischen wie lächerlichen Attacken beißen ins All wie Flöhe in den Äquator, schießen wie Staubpartikel in fremde Galaxien und trampeln im Mi-krokosmos herum wie Elefanten im Porzellanladen. (Die Bilder versagen, den Flöhen, Staubpartikeln, Elefanten und Barbaren ist Abbitte zu leisten, wenn sie als Gleich-nisse herhalten müssen.) Ihr einfältiger Jubel bei jedem fündigen Griff ins Volle wie ins Leere wird nur noch über-troffen von der Grenzenlosigkeit und gleichzeitigen Läch-erlichkeit ihrer Barbarei. Grenzenlos, nur insofern sie nicht wissen, an welcher Stelle des winzigen Makrokosmos und des riesigen Mikrokosmos sie was mit welchen Folgen an-richten. Ein schwacher Trost, daß sie sich selbst und ihres-gleichen in den folgenden Generationen, so es noch wel-che geben sollte, zugrunde richten. Denn auch alle, die sich dagegen stemmen, reißen sie mit in das alles überle-bende schwarze Loch. Was nicht einmal so sein muss,
dem schwarzen Loch wird es möglicherweise gar nicht auffallen, welche Kamikazeflüge einige Ionen auf einem Staubpartikel namens Erde unternehmen.
Beruhige dich. Es wird schon nicht so werden und es ist auch jetzt nicht so, wie du es schilderst, würde Hannia sagen und ihre Hand auf deine legen. Sie hasst die Schwarzweißmalerei und lächelt, tanzt und feiert ange-sichts der in manchen und nicht den schlechtesten Köpfen sich ankündigenden Apokalypse. Der Golem ist listig und hat viele Seiten. Mindestens zwei, die wir sehen und spüren. Leben und Tod, Gut und Böse, wobei das eine das andere sein kann und umgekehrt. Wir selbst sind ein Teil davon, wie die Wellen im Meer. Wie die Kraft des Wassers und der Luft. Kein Leben ohne Tod.
Und was ist dann dabei gut, was böse?
Darauf hat sie nicht geantwortet. Nur jenen Schlauköpfen, die als Propagandisten der menschlich machbaren und ge-machten Katastrophen die Schöpfung riskieren und sich selbst zum Golem erklären in welcher Gestalt auch immer, denen hat sie nicht das Wort geredet. Die ausgestattet mit der Fähigkeit der Reflexion aus kurzsichtigem Eigennutz den anderen bewusst verletzen, quälen und morden. Und sich dabei erheben über die Tiere, die Pflanzen, denen sie ihre mörderischen Absichten unterstellen. Auch wenn ihre Absichten nicht auf Mord ausgerichtet sind, so sind sie dennoch mörderisch. Tierisch wütende blutrünstige Bar-baren sind nicht die Inkarnation des Guten, aber sie sind liebenswerte Geschöpfe im Vergleich zu den rundumdes-infizierten, vakuumverpackten Hightechkillern in Men-schengestalt, die ohne eine Blutspur an den behandschuh-ten Fingern die gesamte irdische Schöpfung schlachten und nur ein Millionstel Nanogramm davon für ein sattes Leben bräuchten. Immersatt -nimmersatt. Sattsein gibt es ohne Hunger nicht. Auch das haben sie vergessen, über-fressen. Und sich verfangen in ihrer Überheblichkeit. Sie müssen sich den Hunger künstlich schaffen, um wieder einmal richtig satt zu werden. Sie müssen immer versuch-en nachzuschöpfen, was sie an der Schöpfung zerstört, zerfressen haben. Und sie scheitern dabei und merken es, wenn überhaupt, dann viel zu spät.
Sei nicht so pessimistisch.
Deine apokalyptischen Gedankenspiele sind auch nur überhebliche Versuche, sich über den Lauf der Dinge zu erheben. Du sollst sie nicht laufen lassen, du musst dich dagegen stellen, du sollst dich dagegen stellen, aber glau-be nicht, daß du der Herr des Verfahrens wärest. Wenn Hannia guter Dinge ist, hat sie dieses faszinierend gleich-gültige, schwankende, verletzlich wirkende starke segeln-de Urvertrauen, das dich umhüllt wie aufsteigender Abend-nebel auf herbstlichen Lichtungen, dich immer wieder ge-biert, wie die aus dem Morgennebel steigende Sonne im Frühling. Er wird es schon richten und er ist weiblich, der Golem hat die Form und das Wesen der Mutter Erde. Sie ist fruchtbar und furchtbar. Sie ist zornig und hat unendli-ches Erbarmen. Sie ist unmenschlich, so unmenschlich, daß sie alles menschliche auffangen kann. Das glaube ich nicht. Die Menschen gehen über die Grenzen der Golem.
Kennst du sie? Nein! Gott sei dank ist die Golem un-menschlich. Menschlichkeit ist der Ausdruck der Hybris der grenzenlosen Überheblichkeit der Menschen, sich über alles zu stellen, über allem zu wähnen, zu machtphanta-sieren. Machtwahn. Machtrausch ? Das wäre nur für stun-den. Es ist ein Wahn. Ein Männerwahn. Herrenmenschen jeglicher Kultur, jeglicher Religion, jeglicher Ideologie.
Frauen sind anders, das weibliche Prinzip, ein Wider-spruch in sich, aber lasse es gelten, nur als Gedanken-konstrukt für eine Weile. Weiber sind anders. Selbst die Zerrbilder einer Hilde Benjamin sind seit der Kommissarin in einem anderen Licht zu sehen. Selbst Mao Tse Tungs Frau – sie wurde von den neuen Kaisern zur Prügelfrau gemacht, Winnie Mandela… Es gibt keine weibliche Ge-schichtsschreibung und auch keine Schilderungen, wie Frauen so werden konnten, wie sie wurden oder wie es Männern gelang sie so zu schildern und diese Schilder-ungen für ihre Herrschaft zu instrumentalisieren.
Ereifere dich nicht so.
Es ist gut, Du magst auch recht haben. Aber du bist naiv und versuchst, in der Achterbahn zu lenken. Wo der Große Wagen längst die von dir übersteuerte Kurve kriegt oder eine ganz andere Richtung nimmt, die du nicht verstehst, die du nicht siehst. Du willst dich wieder in statischen Kon-struktionen fortbewegen. Natürlich gibt es herrschende und herrische Frauen. Vorzeigedamen der Herren, Stroh-puppen, Strohfrauen. Auch in den matriarchalischen Ge-sellschaften gibt es herrschende und herrische Frauen, gibt es Entwicklungen, die ausschlagen, wie die Fieber-kurven der Erde über Hunderte von zig Millionen Jahren der Planetengeschichte. Auf Kalt folgt Heiß, auf Trocken Nass und anders herum. Die Golem wird es richten.
Dort, wo wir nichts ausrichten können. Aber wo wir kön-nen, dort wo sie uns den Platz gelassen hat, dort müssen wir auch, dort sollen wir auch und dort werden wir auch dagegen handeln, trotz aller oder gerade wegen aller Widerstände. Da haben die physikalischen Gesetze einen Teil Wahrheit begriffen. Hier liegt die beruhigende Urangst aller Despoten. Auch derer, die in uns selbst rumoren.
Hannia ist erschöpft, sie redet nur selten so lange und viel und noch seltener so abstrakt. Sie hat nie so geredet.
Sie wollte mit dir kämpfen, um dich kämpfen, weil sie dich mag, und nicht zusehen möchte, wie du dich verrennst, verzappelst. Wohl wissend, daß du nicht aufzuhalten bist in deiner Tretmühle. So wie viele, die sich mit ungeeigne-ten Mitteln zur falschen Zeit, zu früh oder zu spät aufge-lehnt haben. Oh ja, es war notwendig, es war gut, es hat geholfen, es hat genützt, aber es war vergeblich, und es wäre schlimm gewesen, sie hätten es nicht so getan. So denkst du, hätte sie reden können. Hat sie aber nicht.
Möglicherweise trifft Hannia die Milliardenschar ihrer Ge-samtverwandtschaft irgendwo im Jenseits von Euphrat und Tigris, dort, wo sie sich schon oft in ihren Leben hin ge-dacht hatte und hinfliehen sah, meist jedoch hingezwun-gen, hingehetzt. Im Gegensatz zum größten Teil dieser riesigen Mischpoke hat sie und haben ihre Altvorderen erst viel später als der Rest zu jeweiligen Lebzeiten ihrer eth-nisch-kultischen und kulturellen Identität abgeschworen.
Sie ist, so steht es in den Ermittlungsakten, erst 1964 zum christlichen Glauben übergewechselt. Oder war es bereits 1932, als sie bei Lodz ihren späteren Mann kennen lernte und heiraten wollte? Ein Schweizer mit polnischem Na-men, der ein Zweigwerk von Ciba-Geigy in Lodz als kauf-männischer Direktionsassistent co-leitete. Hannia ist christlich beerdigt worden. Oder wurden ihre Urururururur-großeltern schon zum christlichen Glauben gezwungen, wie damals deine Ururururururururururururururururur-großeltern? Sie jedenfalls hat das Martyrium nicht weiter ertragen wollen, als Jüdin erkannt und auch noch nach dem Tod gettoisiert zu werden. Ihr Sohn besuchte nach ihrer Flucht aus Israel ein christliches Internat. Prophylaxe.
Hannia wird christlich beerdigt. Eigentlich wollte Hannia nach der jüdische Zeremonie begraben werden. Sie hatte sich an Main und Kinzig die jüdischen Friedhöfe angese-hen, die das Tausendjährige Reich überlebt und die Nazi-verwüstungen der letzten Jahre einigermaßen unbeschä-digt überstanden hatten. Der Hanauer Judenfriedhof zwi-schen Stadtkrankenhaus und Jahnstraße (Jahn, dieser Judenhasser, Franzosenfresser, und konstitutioneller Mon-archist, warum der wohl noch heute so gefeiert wird?), Der Langenselbolder Judenfriedhof an der Gründau, der Geln-häuser Judenfriedhof am Escher, wo früher Hexen und Juden verbrannt wurden. Dass der Selbolder Friedhof direkt zwischen Rummelplatz, Sportplatz und Mehrzweck-halle in den geschändeten Auwiesen der Gründau liegt, das hatte Hannia nicht gestört. Das ist halt so, mitten im Trubel, im Leben, mitten im Feiern ist der Tod und der ist nicht böse, Trauern und Feiern gehören zusammen. Die Trennung von Diesseits und Jenseits, von Leben und Tod, von Trauern und Feiern, von Lachen und Tränen, Leid und Freude, ist eine Erfindung des päpstlichen Strafregiments, der Lutheraner, der Calvinisten, der Pietisten und auch der Jüdischen „Traditionalisten“, vor denen ich geflohen bin.
Wenn Hannia gewusst hätte, daß die idyllische Lage des Langenselbolder Judenfriedhofes jetzt durch ein schönes Sport- und Fittnesscenter ergänzt wurde, sie hätte im Gegensatz zu den trauernden Denkmalschützern nichts dagegen gehabt: Da pulsiert das Leben, wenn auch auf sonderbare, mir noch nicht zugängliche Weise.
An ihrem Grab versammelte sich eine seltsam gemischte Trauergemeinde: ein frisch aus dem Sonnenstudio kom-mender Vertreter der jüdischen Gemeinde, ihr Sohn, die schmale Blonde mit randloser Brille, der etwas nervig wir-kende elegant gekleidete, graumelierte mit Mondgesicht und Silberrandbrille….
Todesursache: Herzversagen. Keiner der Anwesenden glaubte an eine natürliche Todesursache, bis auf ihren Mann, der will daran glauben. Sie hat sich in ihrem hohen Alter übernommen. Ihr Mann war dagegen, daß sie nach Polen fährt zumal als LKW-Fahrerin. Zweifel am natürli-chen Tod Hannias ergaben sich unter anderem aus einem anonymen Brief, der kurz nach der Beerdigung auf Hannias Grab gefunden wurde.
Liebe Hannia,
dieser Brief wird Dich nicht mehr erreichen.
Ich weiß nicht, warum ich ihn schreibe.
aber ich muss ihn schreiben.
So wie ich Dich kennen gelernt habe, so wie Du gelebt hast, so wie du die mörderischsten Stationen in deinem Leben mit eisernem (?) Lebens- und Überlebenswillen gemeistert hast, ohne andere dadurch in den Tod zu treiben, zu schicken, ja gerade indem du anderen das leben gerettet hast.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß du nur einfach so gestorben bist, daß du aufgegeben hast, daß dein großes starkes Herz einfach versagt hat.
Es muss dir etwas zugestoßen sein, das dich umgebracht hat, wenn dich nicht jemand direkt umgebracht hat.
Vielleicht trage ich Mitschuld, Vielleicht auch andere, was mich aber nicht von meiner Schuld und meinen Schuldgefühlen befreit.
Du hast mich durchschaut, hast mir aber dabei keine Schuldgefühle aufgezwungen..
Du hast mich sehen lassen, wie klein ich eigentlich bin.
wie klein wir sind angesichts der von uns nicht lenkbaren Ereignisse in dieser Zeit und in den Zeiten zuvor.
Du hast mich unendlich beschämt, mir gezeigt, daß es auch in tiefster , in allertiefster Not noch die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen, oder wenigstens zu denken und Nein zu handeln.
Vielleicht habe ich dir den Lebenswillen genommen. indem ich dich ausgesaugt, ausgehorcht habe, Dich überladen habe mit meiner Schuld, mit meinen kleinen und großen nicht verarbeiteten Schuldgefühlen.
Ich habe dich als Fundgrube und als Müllabladeplatz gleichermaßen benutzt, obwohl ich wußte, daß du alles andere brauchtest. Du hättest das Paradies gebraucht und verdient. Dein drittes Leben.
Vielleicht war ich es, der dich umgebracht hat, meine Eitelkeit, mein mich in deinem Leben sonnen und der ungeheuere Versuch sich darin zu spiegeln.
Du wolltest nicht mit deinen Erinnerungen an die Öffentlichkeit. Du hast sie mir im langsam gewachsenen und von mir erschlichenen Vertrauen unter den Siegel der Verschwiegenheit erzählt. Nur für Dich und mich.
Ich habe dich gedrängt und ausgefragt. Es war oft ein voyeurhaftes Aushorchen. Ein Fressen, ein in mich hineinstopfen von Tragödien, die mir kein Fernsehen, kein Film, die mir mein Leben, mein Beruf nicht gegeben, ja geboten hat, so geschmäcklerisch habe ich sie ausgekostet und insgeheim auf ihre Verkäuflichkeit geprüft.
Ich habe dich ausgenommen.
Mit welchem Sinn? Unter dem scheinheiligen Vorwand, dein Leben als mahnendes Dokument zu präsentieren, mit dem Hintergedanken, daß einiges von deiner Glorie auf mich herabstrahlt. Dabei ging es nicht um dich und dein Leben und die vielen Millionen, die dein Schicksal teilten oder gerade nicht teilten, nicht teilen konnten..
Ich kann nicht ermessen, was mein Fragen in dir ausgelöst hat.
Du hast wenig davon gezeigt.
Aber ich kann es mir andeutungsweise vorstellen, wenn ich die in Stummheit erstickten und abgehackten Sätze anderer Zeugen des Grauens höre, wenn ich sehe, wie sie ihre Stimmen in trockenen Tränen verlieren.
Liebe Hannia, gleichgültig, wer und was dich in den Tod getrieben hat. Mein Anteil daran ist vielleicht klein, aber übergroß und nur schwer zu ertragen. Ich kann dich nicht mehr fragen, was ich tun soll. Du hast mich damit allein gelassen.
Jetzt bin ich an der Reihe. Mit einem kleineren, einem kleinlicheren und engeren Herzen, werde ich versuchen, kleinere Dinge zu tun, aber ich werde sie tun, selbst tun.
Du hast mich in die Selbstverantwortung entlassen. Du bist nicht länger die gesuchte Gegen-Übermutter.
Du hast mich nicht eingefangen mit deinen weiten Armen, du hast mich ausgestoßen. Du hast mich nicht an dein Herz gedrückt, nicht an deinem mütterlichen Busen zerdrückt. Du hast mich abgewiesen und mir gezeigt, daß es gut ist, einen klaren kühlen kopf zu haben, zu gewinnen, nicht durch Wärme korrumpierbar zu sein, sich nicht für drei Briketts zu verkaufen und wenn schon, und es muss oft sein, dann eben mit kalkulierend kühlem Verstand.
Wärme ist schön, wenn sie dich umgibt, dich aber nicht gefangen hält.
Obwohl mir die Tränen die Augen vernebeln und Trauer und Wut den Verstand,
ich werde alles daran setzen, heraus zu finden, wer oder was dir dein drittes Leben nahm.
auch, wenn ich dabei nur mich selbst finde.
Ich habe versucht, dich so hoch zu hängen, daß du unmöglich zu erreichen bist, daß dein Leben gottgleich und damit als Vorbild unerreichbar ist. Unnachlebbar. Ich habe nicht dich und deine Person gesehen,
deine Unzulänglichkeiten, deine Fehler habe ich übersehen, wegzensiert, um mich nicht mit dir vergleichen zu müssen.
Ja, DIE konnte das, so was kann ich als normaler Sterblicher nicht. Ich habe weggesehen, als du getanzt und gesoffen hast und geflirtet. Du hast gefeiert, als um dich herum die Menschen im Dreck lagen und hungerten. Du hast gesungen und gelacht, als Trauermine und Büßerhaltung angesagt war. Du hast auf dem Vulkan getanzt und deinen Peinigern den Mazurka demonstriert und geweint, als alle anderen lachten und soffen und tanzten.
Du hast deine Stärke vergessen, wenn es völlig unangebracht erschien und kühl und entschlossen gehandelt, als alles vor Angst erstarrt war.
Aber das war kein Gesetz, keine Regel. Du hast es getan wie eine Schlafwandlerin und nicht wie eine martialische Heldin.
Du hast es getan, weil du es tun musstest. Du hast geplant und gegen deine Pläne gehandelt. Du warst kein Lehrstück und gerade darum warst du eines.
Und das ist es, was nicht in meinen christlich-deutschen Schädel will. Das ist es, was ich nicht wie einen Katechismus lernen kann, nicht wie mathematische Formeln und ideologische Baugerüste.
Ich könnte es leben, wenn ich es wagen würde zu leben.
Du bist nicht tot. Ich aber – so fürchte ich – werde an deinen von mir gestohlenen Leben sterben.
Ich habe dich aufgesaugt.
Trotzdem ich dich wie eine heilige Schrift behandelt habe,
wie ein Reliquienhändler seine geraubten Märtyrergebeine, trotzdem ist etwas von dir in mich gefahren.
Ich spüre es, während ich diesen Brief schreibe.
Aber stur wie ich bin, und du musst es mir verzeihen oder musst es nicht, du wirst es mir verzeihen oder nicht, ich tue es, ich werde suchen, auch gegen deinen Willen, auch ohne deinen Segen.
Ich werde finden, wer oder was deinem physischen Leben ein Ende gesetzt hat. Und ich habe den Verdacht, daß es viele Tatbeteiligte gibt. Gründe zumindest für Beihilfe zum Mord, zum Schlussstrich, zum Totschweigen, zum Tottreten, zum Totreden gibt es sehr viele für sehr Viele.
Dass staatliche Institutionen sich in die Suche nach deinen Totschlägern, -rednern, -schweigern einschalten, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Für sie ist die Ursache deines physischen Todes klar und darüber hinaus müssten sie ja unendlich viele Untersuchungen nachholen.
Denn außer dir sind unendlich viele Menschen auf ähnliche Weise umgebracht worden. Auch und gerade durch jene, die da suchen müssten und es nicht weit hätten.
Ich mußte mich von dir befreien, weil ich dich nicht aushalten konnte.
Du kanntest meine Lebenslügen, so klein und kleinlich, so lächerlich sie auch waren und sind.
Du bist mir nicht gefährlich geworden, weil du meine Karriere hättest zerstören können.
Du hättest aber mein Leben zerstört.
Du hast meinem Leben eine Wendung gegeben, die ich nicht wollte, du hättest ihm eine Wendung geben können, die mir keine Handlungsfreiheit mehr lässt.
Du hast mich daran gehindert, so weiter zu leben, wie ich es mir eingerichtet hatte, wie ich leben wollte.
Deine Existenz hätte mich gezwungen, alles aufzugeben und angesichts eines Scherbenhaufens noch mal von vorne zu beginnen.
Dazu habe ich nicht den Mut, nicht die Zeit und nicht die Kraft.
Ich hätte nicht einmal gewusst wo vorne ist, ob ich erst wieder geboren werden muss. Dein Weiterleben hätte immer hinter mir gestanden. Jede Bewegung hätte ich durch deine Augen beargwöhnen müssen, jede Äußerung, jede Handlung. Du hast mir gesagt, man müsse zu seinen Fehlern stehen, sie annehmen und in der Erkenntnis der eigenen Fehler ohne Asche auf dem Haupt sein leben ändern, anders handeln. Ich kann es nicht. In allem was ich tue, schwingt meine Geschichte mit, ist davon durchdrungen und du stehst neben mir und bist die Meßlatte, die urteilende Instanz. Und dabei nicht verurteilend, so daß ein sich gegen dich wehren um so schwerer wird.
Dich sterben zu sehen, war befreiend, und leichter als dich umzubringen. Und doch viel schwerer. Denn es bleibt keine klare Entscheidung:
Ich habe dich umgebracht.
Es bleibt das nagende Gefühl:
ich hätte dich umgebracht haben können.
Eigentlich sehne ich mich danach, sagen zu können:
Dich umzubringen war befreiend,
bevor du als Übermutter dich über mich beugst und mich erstickst.
Du warst nicht meine Übermutter, aber ich habe mir aus dir eine gemacht.
Mit dem Vater, mit Vätern abzurechnen ist leicht.
Ihre Verbrechen sind gut getarnt versteckt aber leicht zu entdecken.
Aber die der Mütter?
Mütter sind Tabu.
Es ist viel schwieriger, sich von der Mutter und ihrem Schatten zu befreien.
Sie steht in Übergröße und nicht greifbar, unangreifbar über mir und dich traf das Unglück, daß ich dich zur Übermutter gemacht habe.
Ich weiß, daß dein Tod auch mein Ende bedeutet.
Doch lieber ein Ende mit Grauen als ein Grauen ohne Ende.
Du hättest mich sonst schleichend, langsam zerstört.
Ich habe geschrieben, daß kein Staatsanwalt ermitteln wird. Von sich aus nicht.
Erst, wenn sie meinen Brief gefunden haben, werden sie ermitteln. Ich warte darauf, ich bin darauf gefasst, ich hoffe, daß sie nach mir suchen.
Sie werden mich finden und dich leidenschaftslos, gleichgültig rächen und es werden nicht die sein, die dich lieben, die dein Leben und dein Leiden kennen. Es wird ein ganz banaler Akt werden.
Ich werde, wenn ich Glück habe, wegen Totschlags oder Ähnlichem eine Strafe erhalten, in die Psychiatrie eingeliefert und dann ist Schluss, wenn ich ihnen nicht zuvorkomme.
Sie werden mich am Fließband abhandeln, wie jeden anderen gemeinen Totschläger.
Es wird kein Aufschrei durch die Presse gehen. Ich habe dich ja nicht gefoltert, verstümmelt, erstochen, erschlagen, erschossen, erhängt. Ich habe dich nur in den Tod getrieben.
EXPOSEE
Woran ich derzeit neben einigen anderen parallel-aktuell bearbeiteten Projekten schreibe, sind die Rekonstruktionsversuche von 6 durch einen Festplattencrash verlorengegangenen Manuskripten und die aktuellen Bearbeitungen älterer Manuskripte folgender Romane:
- „Putztruppen“ (vollständig verschwunden, Kladdenteile und Rekonstruktionsansätze in Arbeit)
- „Der Damenschneider“(vollständig verschwunden, Kladdenteile und Rekonstruktionsansätze in Arbeit))
- „Grenzgänger“ (neue Bearbeitungen verschwunden, einzelne „Module“ in Anthologien und zeitschriften veröffentlicht )
- „Der Erbsenzähler“ (vollständig verschwunden, einzelne Kladdenteile „wiederentdeckt“)
- „Die Vertreibung aus dem Rosengarten“ (vollständig verschwunden)
- „Als Tito einmal zum Fußballspielen nach Gründau kam“ (ein Dorf-Roman im Entstehen)
- „Zickensturm am Messeturm“ (bis auf einen Kladdentext vollständig verschwunden)
Fünf der oben genannten Romane und ein weiterer im Entstehen begriffene bilden einen Roman-Zyklus mit den Hauptspielzeiten zwischen 1920 und 2000. Alle vier handeln im Bereich des Widerstandes gegen die heraufziehende und dann an die Macht gebrachte faschistische Diktatur ,
handeln vom Krieg und der Nachkriegszeit zwischen Schwarzmarkt, kaltem Krieg und Wirtschaftswunder bis in den „deutschen Herbst“ und weit darüber hinaus ….. jeweils an anderen Spielorten großstädtisch-metropolitan, mittelstädtisch-feudalgeprägt, kleinstädtisch-ländlich und dörflich … es sind historisch-politische „Krimis“.
„Grenzgänger oder die drei Leben der Hannia W.““
„Grenzgänger“ sind sie in vieler Hinsicht, fünf Journalisten auf der Jagd nach der Geschichte einer Frau, die als polnische Jüdin Theresienstadt und Auschwitz überlebt hat und seit ’81 bis 87 Hilfstransporte ins Polen Jaruselskis/Walesas begleitet. Die fünf jagen im Grenzbereich zwischen historischer Verantwortung, investigativem Journalismus und Karriereambitionen Hanna ein zweites Mal durch Theresienstadt/Auschwitz. Hannias drittes Leben endet mit Herzversagen – so steht es im Totenschein. Doch nach Hannias Beerdigung taucht eine dubiose, anonyme Selbstbezichtigung auf. Wer sie in den Tod getrieben hat, bleibt unklar. Die Teilnehmer der Hilfstransporte könnten es ebenso getan haben wie einer der fünf Journalisten: ein prominenter ZDFler, ein Hanauer Kulturjournalist, eine freie Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks, ein verhinderter Spiegelredakteur, der bei einem Anzeigenblatt versauert sowie ein heimatloser linksradikaler Hobbyredakteur mit gleichem Karrierestrickmuster hinter dem „Überzeugungstäter“.
„Putztruppen“
(aus dem Nachruf auf Jochen Schäfer, den Tonmeister des Frankfurter LiteraturTelefons“)
Wir haben uns bei den Aufnahmen erst kennen gelernt. Ich habe ihm meinen Roman “Putztruppen” als Erstem fast ganz erzählt, nachdem der bei einem Festplattencrash über die Wupper gegangen war. Jochen hat bei der Erzählung viele Details mit eingeflochten, denn er kannte, nein, hatte “ein Duzend Oberbürgermeister auf’m Buckel”… Jochen hat mir auch gesagt, dass er die Hauptfigur des Romans persönlich kennt: “Jochen, ich hab den erfunden!” “Nein, des kann net sein, isch kenn den!! „. Mein virtueller Hauptkommissar verblaßte zuhörens neben Jochens Realem „Ich weiß, wo der wohnt. Dem hawwe die Amis nachem Kriesch, e Kneipe hinner die Nikolaikersch gestellt, Geschenkt, mit em Bergepanzer hawwe die e Wellblesch-Halle vom Rebstock gebracht un hiegestellt. Da hat der die ganze Unnerwelt unner Kontrolle, de Schwarzmarkt, die ganze Jazzer, de Emil un de Albert warn dort noch vor de kleine Bockenheimer. Die war doch noch verschütt…” Wenn Jochen in Fahrt kam, hat er geslangt, wie’n eschde Friedrisch Schdolze. Der Meister der Literatur-Töne hat mir den ersten Literaturpreis verliehen : mit meiner Geschichte war ich in Jochens Welt eingedrungen und wir haben gemeinsam das Lied vom KWFF gesungen und auch von seiner polnischen Frau, der Displaced Person, der ex-Zwangsarbeiterin, die jetzt für ihn putzte.. “Isch kenn die genau, na, isch habb se gekannt. Bevor se aus em Fenster gefalle is. Die hat im Riederwald in de Pestalozzi-Schul geputzt ” So hört sich das an, wenn Frankfurter Hochdeutsch reden, es versuchen. Jochen konnte das wunderbar…… Er wollte mir die Karriere dieses Polizei-Hauptkommissars noch genau aufzeichnen…. Im Runterfahrn im Aufzug haben wir festgestellt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben, er nur 10 Jahre früher oder warens 5 ? Ich bin in den 4 Jahren nach der Aufnahme und nach unseren langen Gesprächen danach nicht mehr zu ihm nach Frankfurt gekommen, habe es immer wieder aufgeschoben, weil immer wieder irgendwelche Kriege dazwischen kamen, gegen die ich unbedingt anschreiben musste. Da mussten die “Putztruppen” und auch Jochen erst Mal warten . Und jetzt hat er unsere gemeinsame Geschichte einfach unerzählt …., erzählt ja schon, aber noch lange nicht aufgeschrieben mit ins Grab genommen. Und den Namen des realen Hauptkommissars auch. Also, keine Panik im Polizeipräsidium! Jetzt werde ich die „Putztruppen“, diesen endlosen Roman für Jochen fertig schreiben. ……………………….
“Damenschneider“
Und zum “Damenschneider” nur soviel: der heißt nicht so, weil er einige Damen
zerschnitten haben soll, er sollte mal ein echt eleganter Damenschneider werden, das hat er aber nicht geschafft. Er ist Flickschneider geworden , der Maximilian Meyer aus dem Herzen des Odenwaldes, aus der deutschesten aller deutschen Kleinstädte: aus Michelstadt. Michel, was willst Du noch mehr, wobei Michel nicht der kleine aus Löneberga ist. Michel heißt Groß und Statt heißt Siedlung, es muss sich also schon sehr früh um eine große Siedlung gehandelt haben — von wegen Kleinstadt. Eigentlich der Mittelpunkt der Welt, des Alls – wie Dr. Alsberg es immer brustbaritönig auch im Biologieunterricht des städtischen Gymnasiums verkündete! Alsberg war Heimathistoriker, „Heimatkundler“ sagten die Nicht Akademiker ohne Schmiss. Alsberg spielte eine wichtige Rolle in dieser Stadt und hatte nur einen kleinen aber feinen und eben nicht ungefährlichen Gegner: den aus dem Exil in den USA zurückgekehrten Historiker und von den Amerikanern eingesetzten Entnazifizierer Dr. Mömlinger. Mömlinger hatte jüdische Vorfahren, durfte in Frankfurt an der Johan-Wolfgang von Goethe-Universität nicht mehr lehren und forschen und floh noch lange vor 1939 in die USA. Anhand der Geschichte des zum Wahnsinn getriebenen verhinderten Mathematikers und dann ZwangsDamenschneiders Meyer geht es in bergmännischer Vortriebsweise durch die Geschichte dieser bergmännisch geprägten Stadt, durch die halb abgebrannte Südstadt, die Kiliankapelle und die römische Etappensiedlung, durch die demokratische Revolution 1848 und die Vorläufer, die Arbeiter- und Soldatenräte, durch den Odenwald vor allem durch die Nachbardörfer Erbach, Erdbach, Stockkeim, Rehbach, Steinbach und Steinbuch, …. Durch den Reinfall mit dem Tourismusboom um 806 und seinem unrühmlichen Ende mit den blutschwitzenden Reliquien, die der ungeliebte Schwiegersohn Karls des Großen in Rom hatte stehlen lassen, (Wobei nicht klar ist, ob jetzt in Seligenstadt die echten Knochen liegen. Es gab immer eine wundersame Vermehrung der Petrus- und MarcellinusKnochen – zusammengesetzt ergäben sie wohl einen „Menschen“ in der Größe des DinoSaurusRex.) Es geht durch die beiden Puffs in Michelstadt: den einen im TraumKuschelHotel der Jessika Schwarz, bevor sie das eingerichtet hat, bevor auch der Rechtsanwalt Riedel dort seine Nachkriegskanzlei aufmachte, und den anderen, den RatsherrenPuff im Diebsturm in der Häfnergasse hinterm Fickschuster, der auch noch Gefängniswärter war, wo er für jeden nächtlichen Abseiler zu den frisch gewaschenen Hexen im Turm kräftig kassierte und auch etwas erpresste, denn guter Ratsherr ist teuer. Der zweite Ratsherrenpuff war im zweiten Stock beim Fabiany, wo die Tuchfärber mit ihren angeblich gegen den Diebstahl dort oben aufgehängten Tüchern nur die Einsichtmöglichkeiten aus dem Kirchturm verhängen wollten. Hier ging auch der Pfarrer zum Segnen ein und aus mit leerem Klingelbeutel. Es geht durch die Tropfsteinhöhlen unterm Kiliansfloß, in die Eis-Felsenkeller des Scharfrichters Nord, denn nur vom Töten kann man nicht Leben, durch Rexroth und Tuchfabrik Arzt, durch den Unteren Hammer und Howard-Rotavator, durch den vom Mühlhäusler zum Mühlhäuser aufgestiegenen Frühproleten mit guten Beziehungen zum Standesbeamten/bzw zum Stadtpfarrer, der einfach ab einem bestimmten Punkt der Expansion der Gießerei das „l“ aus dem Häusler strich, durch die Zeller Molkerei, die mal den Bauern gehörte, durch die Badeanstalt, wo Michelstadt mal beinahe Kurstadt geworden wäre, durch die Braunstraße und über den Lindenplatz, um die Bogens wird kein Bogen gemacht, die schwarzen Landtage kommen vor, wie der Kettenmichel mit seiner Rede am Lindenplatz und warum der Bürgerkeller des Frankfurter Autoschiebers „Flüsterwilli“ fast revolutionär wurde, und der Jazzkeller vom Amorbach, (war des auch ein Puff ?) und durchs Amtsgericht und das neue Gefängnis, den Grönersaal, den Altdeutschen Hof und das Deutsche Haus, die Volksversammlung am Schützenhof in Erbach. Und durch den Wiesenmarkt und die Michelstädter Antwort auf diesen feudalen Budenzauber mit viel Roßtäuscherei: durch den Bienenmarkt und die MümlingtalHalle,durchs Drehbuch von „Krähwinkel“ vom Atze Brauner, den Frankfurter Wecker mit Peter Rankenfeld und Heinz Schwenk, durch amerikanische Panzerkolonnen und den Kiosk am B45/47 Dreieck am Schlosspark, den die Eltern des Schwarzbierbrauers betrieben, bevor der das Elfenbein entdeckte, durch das Glockenspiel, das Dr. Alsberg erst einschmelzen ließ um es dann 1961 wieder zu eröffnen: er an der Orgel, an der Klaviatur des gespendeten und in Sinn teilweise wieder gefundenen- noch nicht für den Endsieg eingeschmolzenen Glockenspiels: „Üb immer Treu und Redlichkeit, das spielte er zur Einweihung und alle wussten wer da spielt. Und durch den Thurn&Taxischen Goldenen Löwen, der stehn geblieben ist im Gegensatz zum Thurn-& Taxischen Gasthof in Höchst, durch die Drei Hasen und beim Ulmer durch die Schlupfgasse zum Stadtpark: „Siehst Du nicht im Stadtpark die Laternen?“ Waren Gitte und Rex zur Einweihung da? Ich glaube Ja!. Der republikanische Club und seine Vorgänger, … Dr. Alsberg, der die Skelette der Zwangsarbeiterinnen in der GrafenGruft bei ihrer Entdeckung gesehen hat – hat sie vielleicht auch bei ihrer „Vergruftung“ gesehen? Zugeteilt hatte er sie noch lebendig. Sein Gegenspieler, der aus dem Exil zurückgekehrte Dr.Mömlinger kommt bei einem Sturz vom Baugerüst in der Einhardsbasilika ums leben. Sein Aufschlag klang wie wenn man ein Buch zuschlägt. Wie ein Stapel Papier, aber niemand hat es gehört.. Über die Todesfälle legt sich der abendliche Nebel des Mümlingtales.
Aber es gibt Menschen, die denken so in der Orangenzeit im Dezember , wenn nach dem Schälen die Hände ölig glänzen und riechen wie beim Stollenbacken immer wieder an die Stunden mit Dr. Mömlinger in der Orangerie – von der die Eltern nur wussten, dass es dort Nachhilfestunden für ihre Kinder gab. Zu kleinen Preisen. Das konnten sich sogar auch die Prolos leisten….
„Der Erbsenzähler“
Die Rekonstruktion des zu einem Drittel fertigen Manuskriptes des „Erbsenzähler“s muss noch etwas warten: Es ist die Geschichte einer auseinandergehenden Freundschaft zwischen Gregor Mendel und seinem Schulfreund Hans Kudlich, der als Paulskirchenabgeordneter Dr. Kudlich zum oberschlesisch-böhmischen Bauernbefreier wird. Gregor Mendel -Sohn verarmter Bauern gefördert durch die katholische Geistlichkeit, zieht sich ins Kloster zurück – dem gemeinsamen Schwur , die Lage der Bauern zu verbessern versucht er treu zu bleiben – indem er über Kudlich Kontakt zu Justus Liebig aufnimmt und durch seine Forschungen eine Saatgutverbesserung für die Bauern erreichen will. Er verstrickt sich jedoch in seiner Mani, immer wieder den Beweis antreten zu müssen, dass er trotz seines verräterischen Namens kein Jude ist, in die antisemitischen (fast)Pogrome der 1840er und 50er, die vom katholischen KuK-Klerus angefeuert werden. So wird er zum politischen Feind seines Freundes Kudlich, der entschiedener Gegner der Antisemiten unter den 1848ern ist…. Dass aus der von Gregor heimlich und unheimlich ersehnten Liaison mit Kudlichs Schwester nichts wird, liegt angesichts seines klerikalen Aufstiegs deswegen auf der Hand, weil er denn doch nicht so hoch aufsteigt, dass er sich eine heimliche Geliebte oder Maitresse halten könnte. Ein Abt ist eben noch kein Bischof.
Zwei Gedichtbände standen ebenfalls vor dem Abschluss und sind leider auch zusammen mit drei Kinderbüchern abgestürzt. Die Lyriksammlungen sind aber bereits schon wieder zu jeweiligen Doppel-Bänden angewachsen: „Stimmabgabe“ und „GeBlödelDichte“, die so Mancher auch GernHat…
In einer ersten Stufe will ich die drei am engsten miteinander verzahnten Romane des Zyklus rekonstruieren bzw. fertig schreiben: „Grenzgänger“, „Putztruppen“ und „Damenschneider“. In diesen drei Romanen spielen jeweils in Randbereichen Figuren eine Rolle, die die Romane miteinander verbinden. Der Stoff der Romane insgesamt stammt aus „oral history“ und aus Dokumenten aus Archiven, die ich bei meinen Recherchen durchforstet habe…
Textauszug aus dem Roman „PUTZTRUPPEN“
(erster Rekonstruktionsversuch – ein Rohling aus der Bearbeitung)
……. Er roch als Kind eben wie ein Sozi so riecht – da konnte ihn die Mutter schrubben wie sie wollte, das machte es oft nur noch schlimmer nach den Schrubborgien roch er nach Kernseife und Sagrotan. “Bub, kämm dich, HAST DU DIE FINGERNÄGEL AUCH GEBÜRSTET ?” Es hat alles nichts genützt. Die kaum noch bezahlbaren Nachhilfestunden brachten ihn nicht so weit, dass er durch glänzende Leistungen und Bestnoten seinen Sozigeruch wettmachen konnte. Es kam dann eben doch alles zusammen: im Gagern-Gymnasium wollte sich niemand mehr neben ihn setzen, das Geld für die Nachhilfe wurde eingespart, und schließlich war er auch froh, dass er auf die Realschule wechseln konnte. Da konnte er alles aus dem FF, so wurde er begrüßt, bei Fritz Finkh war das so, – der kanns aus dem FF ! Der gescheiterte Gagern Gymnasiast wurde zum Klassenbesten in der Realschule. Und war immer blitzsauber. Und dann war er auch noch im Turnverein, nein ! nicht bei denne Juddebuuwe, bei der Eintracht, sondern im 2 fachen FF: im Frisch, fromm, fröhlich, freien Turnverein – und in der Tradition des Turnvaters Jahn. Der passte zu Finkh und Finkh passte zu IHM. Rennen konnte er auch noch so toll: er war nicht nur Frisch, Fromm. Fröhlich und Frei, er war flink der Finkh wie ein Windhund und hart wie Kruppstahl und auch zäh, zäh wie Offenbacher Leder. Und die jungen Damen aus dem Elisabethen-Gymnasium im Westend, das war doch etwas ganz anderes als abgeroppte Dinger aus Fechenheim, aus dem Riederwald, aus dem Ostend. Ihm wurde ganz anders in der Magengegend, wenn er die Mädchen aus den der Ouarta, der Untertertia jetzt als höhere Töchter, als Damen der Gesellschaft mit den Herren Söhnen der Frankfurter Hautevolee am Nizza flanieren sah. Das war auch noch besser als die Bäcker- und Metzgertöchter, die das Gymnasium entweder gerade so schafften oder mit zwei Mal Sitzen- bleiben von der Schulbank weggeheiratet wurden – von Metzgern und Bäckern und besseren Kneipenwirten, Manche schafften es ja auch bis zur Hotelierfrau, aber dann war meist Ende der Fahnenstange.. Die Garderobe war dementsprechend nicht Haut-Couture sondern von der Stange, . Französisch war weder sprachlich noch im Bett sein Ding: was er fließend beherrschte war Blümmo, Portmonnee, Schäßlong, Trottwar, auch Tollette, statt Scheißhaus ging ihm gut über die Lippen und jener Sachsenhäuser Warnruf für frühreife Metzgertöchterchen aus der Franzosenzeit: Machmer bloß kaa Fissematente!” Das wusste Willem schon als Ouartaner, als es mit der Quälerei mit dem Französisch losging: das hieß ursprünglich ”visiter ma tente” und war die Frage napoleonischer Offiziere, die in Sachsenhausen einquartiert waren also kurz vor Francfort – an die berühmten Sachsehäuser MetzjersTöschtersche: “Voulez vous visiter ma tente ce soir? “ (Möchten Sie heute Abend mein Zelt besuchen? )
Willem wollte die zerbrechlich aussehenden Bankiers-Töchter, diese Engelsgesichter, diese unerreichbaren hochgeschnürten Engelsbrüste, diese guten Feen seiner Träume vor dem Schmutz und dem Bösen schützen, so wie das Vaterland und die deutsche Scholle vor Hunnen und Bolschewisten, wie Prinz Eugen einst Wien vor den Muselmanen.
Finkh wird wegen seiner guten Kenntnisse im Millieu der Kommunisten und der Frankfurter Kleinkriminellen -”das ist eh das gleiche Pack, die gleiche Mischpoke” – zu seinem Erstaunen von den Nazis nicht entlassen, nicht verhaftet – nein bruchlos übernommen, auf die neue Ordnung eingeschworen -und die konnten das auch ohne jeden Kompromiss durchziehen ! Frankfurt säubern !
1973 wird Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh im Hinter-Hof einer besetzten Westendvilla erschlagen aufgefunden. Neben ihm ein Obdachloser mit einem Wasserrohrstück in der einen und einer Flasche Fusel in der anderen Hand. Das Rohr passte genau in die Delle auf dem Finkh’schen Kopf, das Rohr hatte sich auch etwas aus der dünn gewordenen Finkh’schen Haarpracht mitgenommen
und mit echten Finkhenblut angeklebt. Die Sache war glasklar und der Obdachlose konnte auch nicht beweisen, dass er mit vier schluck aus der noch fast vollen Flasche bereits schuldunfähig alkoholvergiftet war. Nach 10 Jahren Preungesheim erhängt sich der arme Müll-Schlucker in seiner Zelle, hinterlässt nach 10 Jahren Tatleugnung nun doch noch ein “Bekennerschreiben”.
Das wiederum erweist sich bei erneuter Fahndung im Umfeld des Todesfalles Finkh als Fälschung: Wer hat den Finkh ermordet? Finkh ist als “Widerständler” -weil er ja so viele SPD’ler und Gewerkschafter und auch Kommunisten und jüdische Familien retten konnte – na ja oft ging es halt partout nicht. Er war ja umgeben von echten Nazis und konnte auch nicht jede Familie retten, ermusste auch mal die eine oder andere ausliefern, einliefern, er musste auch SPD’ler und Kommunisten verhaften, sonsst wäre ich doch sofort aufgefallen und hätte dann niemand mehr retten können !- Finkh wird von der Militärregierung mit dem Aufbau der entnazifizierten demokratischen Frankfurter Kriminalpolizei beauftragt, liefert einerseits gute bekannte an die Spruchkammer, liefert aber auch gegen Bares beste Persilscheine, kennt den Schwarzmarkt und den lieben Schieber Fritz Kietz, weiß wer später bei der Rosemarie im 190er saß und dann auf ihrem Schoß oder sie auf den immer noch furchtbar fruchtbaren absoluten Herrscherschößen .
Was ? Seit wann gebären hier die Männer ? Das bleibt Frauensache – auch im Puff. Ach ja seine Kneipe hinter der Nikolaikirche, die hatten ihm die Amis geschenkt, fürs erste nach dem verlorenen Krieg. Und da waren sie alle drin, der Ossi Büttner, der Finkh hat sich mit seiner nachnoskischen NaziPutztruppe ein Vermögen erpresst, hat jüdische Bürgerstöchterchen an braune Goldfasane verkuppelt und dopppelt kassiert, bei den einen wegen der Rassenschande bei den anderen, wegen der benötigten Geld- und Goldmittel zur Beschaffung von gefälschten Papieren für die Flucht und für die Bestechung von Nazis und Mitläufern, Reichsbahn-Schaffnern, -Zug- und Unterscharführern bei der SS. Eines der verkuppelten Mädchen ist die Mutter der zweiten Hauptfigur in dieser Geschichte. Ihre Familie verspricht Finkh vor den Krematorien in Auschwitz zu retten. Sie opfert sich und macht die Beine breit für eine Frankfurter Nazigröße. Finkh lässt sie im Unklaren darüber, ob die Familie jetzt gerettet ist oder nicht. Er dringt darauf, dass sie aus Deutschland verschwindet. Über seine Kontakte zu den Gewerkschaftern von Untergrund-KPD und -SPD in Hamburg und bei der Reichsbahn kann sie ausgestattet mit falschen Papieren in Hamburg überleben und mit einem brasilianischen Frachtschiff via Südamerika die USA erreichen, wo sie in der Exilgemeinde von der Vernichtung ihrer gesamten Familie in Auschwitz erfährt. Im Exil noch lernt sie den konfessionslos- sozialdemokratischen Naturwissenschaftler Professor Schwarzmüller kennen, der nach dem Krieg zurück nach Kiel kommt und dort die Universität mit wiederaufbaut. 1947 bringt sie ihren ersten Sohn zur Welt: Johannes Schwarzmüller.
Finkh hat in Frankfurt die Aufgaben im Vorfeld des Verbots der KPD recht gut gelöst. Er sieht zu, dass möglichst alle ausgeschaltet werden, die sein eindeutiges Doppelspiel durchschauen könnten oder durchschauen. Er gibt den Kumpel und den Frühwarner bei Razzien sowohl in den Druckereien der KPD als auch bei den Radfahren des Solidaritätsverbandes, bei den Kleinkriminellen in der Hasengasse, deren unterirdische Verbindungen zur Kleinen Bockenheimer er noch besser kennt als Emil Reichenstadt, der “Swinging Handkäs” im Jazzkeller. Er weiß auch wo die Gänge unter dem ehemaligen Judenghetto in Richtung Fischerfeld führen und in welchen Kellern Ein- und Ausstiege zu finden sind. Einer dieser Ausgänge muss sich in einer Nische der Rauschgifthöhle namens “Aquarius” befinden. Doch das war nicht sein Ding. Das Rauschgiftdezernat war für ihn nur eine Einstiegshilfe in eine Szene, deren Sprache er im Gegensatz zu seinem fast angeborenen Proletenslang und seinem Parteikathechismen-Deutsch nicht ansatzweise beherrschte: er musste lesen lernen, da gab es von Bonn aus Anweisungen, vom Generalbundesanwalt, vom LKA- Wiesbaden – Fortbildungskurse
auch bei Leuten aus dem fernen Pullach: Parteichinesisch, Psychologie, Soziologie .. dafür wurden sogar Professoren extra von Köln nach Frankfurt gescheucht in die Friedrich-Ebert-Anlage, um dort an Wochenenden ihm und seinen Kollegen das nötige Vokabular für die “Neue Linke” beizubringen. Das
machten diese Professoren sogar im Doppelpack zusammen mit Offiziersanwärtern der Bundeswehr: Staatsbürger in Uniform ! Fritz machte das Spielchen mit – aber mit Groll im Bauch. Kurz vor seiner Pensionierung sollte er sich von diesen jungschnöseligen Schwätzern noch sagen lassen, wohin die Reise zu gehen hätte. Der Professor Schlauch tat seinem Namen alle Ehre und schlauchte sie, was das Zeug hielt. …………………………….….. Finkh nannte diesen persilscheinfreien Karrieresprint nur bissig den “Quandtensprung”, ohne genau zu wissen, was der denn tatsächlich in der Wissenschaft bedeutete: das war dann doch manchmal ein Handykap mit nur der Mittleren- Reife. Mit einem Gaggern-Abitur hätte er es gewusst. Pech ! Aber man kann halt nicht alles haben im Leben. Pech für die beiden war, dass es schon auffiel, dass sie mit BMW-Motorrädern arbeiteten, wo doch die Bad Homburger Konkurrenz Horex kostengünstiger und auch noch besser war. Alt eingesessene persilweißgewaschene Firmen hatten immer weniger Interesse Aufträge an ein Unternehmen zu geben, das im Rhein-Main-Gebiet als eine NaziFirma bekannt war und zudem auch noch von Leuten angeschoben wurde, die in Nürnberg vor dem US-Ankläger gestanden hatten. Das hatte zunächst auch negative Wirkungen auf die Auftragsbücher – die öffentliche Hand , das rote Hessen, aber auch die US-Army vergaben möglichst keine Aufträge an Unternehmen, die mit öffentlich bekannten Nazis zusammenarbeiteten. Klar sah das schon in den frühen 50ern hinter den Kulissen ganz anders aus. Man brauchte dann ja auch wieder solche Kerle – hart wie Kruppstahl -, um Aufzuräumen ! Und Leute, die aus dem Schwarzmarkt auf den Weltmarkt aufsteigen wollten, mussten sich Mitwisser und lästige Schmuddelkonkurrenz vom Hals halten oder schaffen. Und so kamen die Kameraden von der Putztruppe doch wieder zusammen. Während die einen privat nicht selten Mäuler knebelten und Hände fesselten waren den anderen da die Hände gebunden durch Gesetze und andere Fesseln.
Es war eine gedeihliche Arbeitsteilung, ein eifriges Hin und Herrichten zwischen Autobahnraststätten, Frankfurter Kreuzen ohne sichtbare Haken, Hafen und Flughafenbau bis hin zur U-Bahn und ein professionelles Hinwegsehen und Ein- und Abgreifen. ……..
TEXTAUSZUG aus dem Roman „Grenzgänger…“
…… Ihr einfältiger Jubel bei jedem fündigen Griff ins Volle wie ins Leere wird nur noch übertroffen von der Grenzenlosigkeit und gleichzeitigen Lächerlichkeit ihrer Barbarei. Grenzenlos, nur insofern sie nicht wissen, an welcher Stelle des winzigen Makrokosmos und des riesigen Mikrokosmos sie was mit welchen Folgen anrichten. Ein schwacher Trost, daß sie sich selbst und ihresgleichen in den folgenden Generationen, so es noch welche geben sollte, zugrunde richten. Denn auch alle, die sich dagegen stemmen, reißen sie mit in das alles überlebende schwarze Loch. Was nicht einmal so sein muss, dem schwarzen Loch wird es möglicherweise gar nicht auffallen, welche Kamikazeflüge einige Ionen auf einem Staubpartikel namens Erde unternehmen.
Beruhige dich. Es wird schon nicht so werden und es ist auch jetzt nicht so, wie du es schilderst, würde Hannia sagen und ihre Hand auf deine legen. Sie hasst die Schwarzweißmalerei und lächelt, tanzt und feiert angesichts der in manchen und nicht den schlechtesten Köpfen sich ankündigenden Apokalypse. Der Golem ist listig und hat viele Seiten. Mindestens zwei, die wir sehen und spüren. Leben und Tod, Gut und Böse, wobei das eine das andere sein kann und umgekehrt. Wir selbst sind ein Teil davon, wie die Wellen im Meer. Wie die Kraft des Wassers und der Luft. Kein Leben ohne Tod. Und was ist dann dabei gut, was böse?
Darauf hat sie nicht geantwortet. Nur jenen Schlauköpfen, die als Propagandisten der menschlich machbaren und gemachten Katastrophen die Schöpfung riskieren und sich selbst zum Golem erklären in welcher Gestalt auch immer, denen hat sie nicht das Wort geredet. Die ausgestattet mit der Fähigkeit der Reflexion aus kurzsichtigem Eigennutz den anderen bewusst verletzen, quälen und morden. Und sich dabei erheben über die Tiere, die Pflanzen, denen sie ihre mörderischen Absichten unterstellen. Auch wenn ihre Absichten nicht auf Mord ausgerichtet sind, so sind sie dennoch mörderisch. Tierisch wütende blutrünstige Barbaren sind nicht die Inkarnation des Guten, aber sie sind liebenswerte Geschöpfe im Vergleich zu den rundum-desinfizierten, vakuumverpackten Hightechkillern in Menschengestalt, die ohne eine Blutspur an den behandschuhten Fingern die gesamte irdische Schöpfung schlachten und nur ein Millionstel Nanogramm davon für ein sattes Leben bräuchten. Immersatt -nimmersatt. Sattsein gibt es ohne Hunger nicht. Auch das haben sie vergessen, überfressen. Und sich verfangen in ihrer Überheblichkeit. Sie müssen sich den Hunger künstlich schaffen, um wieder einmal richtig satt zu werden. Sie müssen immer versuchen nachzuschöpfen, was sie an der Schöpfung zerstört, zerfressen haben. Und sie scheitern dabei und merken es, wenn überhaupt, dann viel zu spät.
Sei nicht so pessimistisch. Deine apokalyptischen Gedankenspiele sind auch nur überhebliche Versuche, sich über den Lauf der Dinge zu erheben. Du sollst sie nicht laufen lassen, du musst dich dagegen stellen, du sollst dich dagegen stellen, aber glaube nicht, daß du der Herr des Verfahrens wärest. Wenn Hannia guter Dinge ist, hat sie dieses faszinierend gleich-gültige, schwankende, verletzlich wirkende starke segelnde Urvertrauen, das dich umhüllt wie aufsteigender Abendnebel auf herbstlichen Lichtungen, dich immer wieder gebiert, wie die aus dem Morgennebel steigende Sonne im Frühling. Er wird es schon richten und er ist weiblich, der Golem hat die Form und das Wesen der Mutter Erde. Sie ist fruchtbar und furchtbar. Sie ist zornig und hat unendliches Erbarmen. Sie ist unmenschlich, so unmenschlich, daß sie alles menschliche auffangen kann. Das glaube ich nicht. Die Menschen gehen über die Grenzen der Golem. Kennst du sie? Nein! Gott sei dank ist die Golem un-menschlich. Menschlichkeit ist der Ausdruck der Hybris der grenzenlosen Überheblichkeit der Menschen, sich über alles zu stellen, über allem zu wähnen, zu machtphantasieren. Machtwahn. Machtrausch ? Das wäre nur für Stunden. Es ist ein Wahn. Ein Männerwahn. Herrenmenschen jeglicher Kultur, jeglicher Religion, jeglicher Ideologie.
Frauen sind anders, das weibliche Prinzip, ein Widerspruch in sich, aber lasse es gelten, nur als Gedankenkonstrukt für eine Weile. Weiber sind anders. Selbst die Zerrbilder einer Hilde Benjamin sind seit der Kommissarin in einem anderen Licht zu sehen. Selbst Mao Tse Tungs Frau – sie wurde von den neuen Kaisern zur Prügelfrau gemacht, Winnie Mandela…
Es gibt keine weibliche Geschichtsschreibung und auch keine Schilderungen, wie Frauen so werden konnten, wie sie wurden oder wie es Männern gelang sie so zu schildern und diese Schilderungen für ihre Herrschaft zu instrumentalisieren.
Ereifere dich nicht so. Es ist gut, Du magst auch recht haben. Aber du bist naiv und versuchst, in der Achterbahn zu lenken. Wo der Große Wagen längst die von dir übersteuerte Kurve kriegt oder eine ganz andere Richtung nimmt, die du nicht verstehst, die du nicht siehst. Du willst dich wieder in statischen Konstruktionen fortbewegen. Natürlich gibt es herrschende und herrische Frauen. Vorzeigedamen der Herren, Stroh-puppen, Strohfrauen. Auch in den matriarchalischen Gesellschaften gibt es herrschende und herrische Frauen, gibt es Entwicklungen, die ausschlagen, wie die Fieberkurven der Erde über Hunderte von zig Millionen Jahren der Planetengeschichte. Auf Kalt folgt Heiß, auf Trocken Nass und anders herum. Die Golem wird es richten. Dort, wo wir nichts ausrichten können. Aber wo wir können, dort wo sie uns den Platz gelassen hat, dort müssen wir auch, dort sollen wir auch und dort werden wir auch dagegen handeln, trotz aller oder gerade wegen aller Widerstände. Da haben die physikalischen Gesetze einen Teil Wahrheit begriffen. Hier liegt die beruhigende Urangst aller Despoten. Auch derer, die in uns selbst rumoren.
Hannia ist erschöpft, sie redet nur selten so lange und viel und noch seltener so abstrakt. Sie hat nie so geredet.
Sie wollte mit dir kämpfen, um dich kämpfen, weil sie dich mag, und nicht zusehen möchte, wie du dich verrennst, verzappelst. Wohl wissend, daß du nicht aufzuhalten bist in deiner Tretmühle. So wie viele, die sich mit ungeeigneten Mitteln zur falschen Zeit, zu früh oder zu spät aufgelehnt haben. Oh ja, es war notwendig, es war gut, es hat geholfen, es hat genützt, aber es war vergeblich, und es wäre schlimm gewesen, sie hätten es nicht so getan. So denkst du, hätte sie reden können. Hat sie aber nicht.
Möglicherweise trifft Hannia die Milliardenschar ihrer Gesamtverwandtschaft irgendwo im Jenseits von Euphrat und Tigris, dort, wo sie sich schon oft in ihren Leben hin gedacht hatte und hin fliehen sah, meist jedoch hingezwungen, hingehetzt. Im Gegensatz zum größten Teil dieser riesigen Mischpoke hat sie und haben ihre Altvorderen erst viel später als der Rest zu jeweiligen Lebzeiten ihrer ethnisch-kultischen und kulturellen Identität abgeschworen. Sie ist, so steht es in den Ermittlungsakten, erst 1964 zum christlichen Glauben übergewechselt. Oder war es bereits 1932, als sie bei Lodz ihren späteren Mann kennen lernte und heiraten wollte? Ein Schweizer mit polnischem Namen, der ein Zweigwerk von Ciba-Geigy in Lodz als kaufmännischer Direktionsassistent co-leitete. Hannia ist christlich beerdigt worden. Oder wurden ihre Urururururur-großeltern schon zum christlichen Glauben gezwungen, wie damals deine Ururururururururururururururururur-großeltern? Sie jedenfalls hat das Martyrium nicht weiter ertragen wollen, als Jüdin erkannt und auch noch nach dem Tod gettoisiert zu werden. Ihr Sohn besuchte nach ihrer Flucht aus Israel ein christliches Internat. Prophylaxe. Vorsorglich. Hannia wird christlich beerdigt. Eigentlich wollte Hannia nach der jüdische Zeremonie begraben werden. Sie hatte sich an Main und Kinzig die jüdischen Friedhöfe angese-hen, die das Tausendjährige Reich überlebt und die Naziverwüstungen der letzten Jahre einigermaßen unbeschä-digt überstanden hatten. Der Hanauer Judenfriedhof zwischen Stadtkrankenhaus und Jahnstraße (Jahn, dieser Judenhasser, Franzosenfresser, und konstitutioneller Monarchist, warum der wohl noch heute so gefeiert wird?), Der Langenselbolder Judenfriedhof an der Gründau, der Geln-häuser Judenfriedhof am Escher, wo früher Hexen und Juden verbrannt wurden. Dass der Selbolder Friedhof direkt zwischen Rummelplatz, Sportplatz und Mehrzweckhalle in den geschändeten Auwiesen der Gründau liegt, das hatte Hannia nicht gestört. Das ist halt so, mitten im Trubel, im Leben, mitten im Feiern ist der Tod und der ist nicht böse, Trauern und Feiern gehören zusammen. Die Trennung von Diesseits und Jenseits, von Leben und Tod, von Trauern und Feiern, von Lachen und Tränen, Leid und Freude, ist eine Erfindung des päpstlichen Strafregiments, der Lutheraner, der Calvinisten, der Pietisten und auch der Jüdischen „Traditionalisten“, vor denen ich geflohen bin.
Wenn Hannia gewusst hätte, daß die idyllische Lage des Langenselbolder Judenfriedhofes jetzt durch ein schönes Sport- und Fittnesscenter ergänzt wurde, sie hätte im Gegensatz zu den trauernden Denkmalschützern nichts dagegen gehabt: Da pulsiert das Leben, wenn auch auf sonderbare, mir noch nicht zugängliche Weise.
An ihrem Grab versammelte sich eine seltsam gemischte Trauergemeinde: ein frisch aus dem Sonnenstudio kommender Vertreter der jüdischen Gemeinde, ihr Sohn, die schmale Blonde mit randloser Brille, der etwas nervig wirkende elegant gekleidete, graumelierte mit Mondgesicht und Silberrandbrille…. Todesursache: Herzversagen. Keiner der Anwesenden glaubte an eine natürliche Todesursache, bis auf ihren Mann, der will daran glauben. Sie hat sich in ihrem hohen Alter übernommen. Ihr Mann war dagegen, daß sie nach Polen fährt zumal als LKW-Fahrerin. Zweifel am natürlichen Tod Hannias ergaben sich unter anderem aus einem anonymen Brief, der kurz nach der Beerdigung auf Hannias Grab gefunden wurde.
Noch ein Textauszug aus „GRENZGÄNGER….“
Es roch nach geronnenem Blut, angesengten Borsten, nach Schweinescheiße und Männerschweiß.
Ein schmieriger Film lag auf dem Asphalt, ein glitschiger dünner Brei aus Exkrementen, Knochenmehl, Innereien, Altöl, Benzin und breitgefahrenen dürren, dünnen Pappelästen und -blättern
die der Frühsommerwind morgens aus den Bäumen geblasen hatte, kurz bevor es anfing zu regnen.
Frühsommerwind war übertrieben. Ein sterbender Hauch vielleicht. Doch die Pappeln waren so erbärmlich dürr, daß sie auch ohne diesen Hauch jederzeit hätten kippen können.
Die schnelle innerstädtische Notbegrünung blätterte ab, wie der verrußte, ehemals bunte Anstrich in der düsteren Straßenunterführung nebenan. Sie starb ab wie die krebsgeschwürigen Linden in der Frankfurter Landstraße, durch die er gekommen war. Daß es früher mal eine Allee war, konnte man gerade noch erkennen, wenn die heruntergelassene Bahnschranke den Weg zur Stadtmitte versperrte und die gottgegebene Zwangspause einen Blick durch die Fondscheibe ermöglichte.
Er hatte lange keine Schranke mehr gesehen, zumindest in Deutschland nicht, und so sah er sich plötzlich in die sechziger, eher noch in die fünfziger Jahre zurückversetzt. Er rechnete fest mit dem pausbäckig stampfenden Vorbeibrausen einer Dampflock, wenigstens mit dem Vorbeirumpeln eines dunkelroten Schienenbusses und war enttäuscht, als dann doch nur eine Diesellock mit einem endlos scheinenden Güterzug im Schlepp vorbeirauschte und -ratterte. Der letzte Güterwaggon verschwand mit einem floppenden Geräusch zwischen den Bäumen der Kleingärten, die den Bahndamm säumten.
Der Taxifahrer ließ den Motor wieder an. Jeden Moment mußten sich die Schranken öffnen.
Aber nichts geschah. Gegenüber im Schrankenwärterhäuschen keine Bewegung hinter den matten Scheiben mit den ausgebleichten Vorhängen. Offenbar war es unbesetzt. Die über Fenster und Außenwände gesprühten Sprüche deuteten darauf hin,daß auch nachts kein Schrankenwärter die Kurbel bediente. Trotz eines ins Fenster ragenden Hakenkreuzes war sie neben dem Schreibtisch mit seiner schwarz beschirmten Dienstlampe gut zu erkennen: Die Kurbel sah aus wie ein eingeschrumpfter, kopfloser Wachsoldat, der im Stechschritt mit gestreckten Armen erstarrt und seit einer Ewigkeit nicht mehr abgelöst worden war. „Automatische Schranke“, knotterte der Taxifahrer, ohne sich umzudrehen, “ die geht erst hoch, wenn der Zug im Bahnhof einfährt.“ Gleichgültiges Achselzucken. „Vielleicht lassen die auch noch einen Gegenzug durch.“
„Kann ich mal kurz aussteigen?“ Der Mann vor ihm nickte und stellte den Motor wieder ab.
Dieses Anhalten war befreiend – wenn man es als Schicksal hinnahm und sich fügte.
Der abrupte Wechsel von der vierspurigen Autobahn auf die schmale Allee war ihm zu schnell gegangen. Die Bäume waren an ihm vorbei gerast und hatten ihm keine Zeit gelassen für die vergilbten unscharfen Bilder, die diese holprige Straße in ihm aufrüttelte. Laufende Bilder waren es, mit eckigen Bewegungen und ruckender Kameraführung und dem krächzend schnarrigen Kommentarton eines frisch entnazifizierten Frontberichterstatters der jetzt bei der Fox Tönenden Wochenschau wiederverwendet mit seiner Sieg-Heil-heißergegrölten Stimme den kalten Krieg an der alten und neuen Ostfront anheizen durfte. Schulwegathmosphäre. Holzvergaser, unzählige in den Wind gebeugte Schiebermützen auf ebenso unzähligen Adlerfahrrädern. Oder waren es Wandererfahrräder oder Opelfahrräder? Kartoffelsäcke über den Querstangen. Krückenbestückte ovale Schildkappen, die den Volkssturm überlebt hatten. Kopftücher im Joch der Leiterwagen.
Hinkende Henkelmänner und Trümmerfrauen. Gegerbte Gesichter, geschmirgelte Hände,
eingefallene Wangen. Schwarzmarktschieber und Kohlenklau. Die Lok pfiff zweimal. Das Zeichen zum Sturm auf Briketts, Koks und Eierkohlen Apfelsinen werfende Amilaster trieben laut hupend ein Pferdegespann vor sich her. Echte Neger lachten breit aus den Türmen ihrer Panzer. Kaugummisammelnde Kinder. oder waren es Kippen oder CocaCola-Kronkorken?
Und er mitten drin. In kurzen Hosen und Kniestrümpfen mit Kochtopfhaarschnitt und Rotznase.
Er nutzte die seltene Gelegenheit, sich ungefährdet mitten auf die Straße stellen zu können, fühlte – sich streckend – den leichten, wohligen Kitzel der vorsätzlichen Verletzung der Straßenverkehrsordnung, bis ihn der schwitzend wichtig und gewichtig heran eilende Schutzmann wild gestikulierend von der Fahrbahn jagte. Die uralte Angst beim Äpfelklauen vor dem Feldschütz. Der lauert hinter der Hecke. Gleich kommt er um die Ecke.
Er drehte sich um. Hinter dem Taxi hatte sich eine Autoschlange gebildet, die bis zur nächsten Kreuzung reichte. Jetzt mußte der dicke fette Unkerich, der Krötenpolizist aus Lurchis Abenteuern auf der Kreuzung erscheinen und den Verkehr regeln. „Salamander, Beine auseinander, Steck ihn rein, Noch zu klein , Beine wieder zu ,Und aus bist du !“ Oder hieß es: “Zieh ihn wieder raus und du bist aus !“ ? Kein Wunder, daß hier die Linden eingehen. Jemand schien sie mit Kinderreimen ausgezählt zu haben: „Und aus bist du!“ Die Alleeränder sahen aus wie skorbuttgelichtete Zahnreihen. Die frisch gepflanzten schmalbrüstigen Lückenbüßer waren zum Teil schon den schnellen Kindstod gestorben. Die Überlebenden hatten kaum eine Chance so alt zu werden wie ihre stoßstangenverbeulten krebsgeschwürigen Eltern. Und trotzdem gefiel ihm diese Allee. Wie die schattenspendenden Hohlwege, die bei Schulwandertagen Sonnenbrand und Durst erträglich werden ließen: hinter der nächsten Biegung fängt das Dorf an, plätschert ein Brunnen, gibt es einen Laden, einen Kiosk. Kein Geld aber endlich Wasser. Trinken. Kühl streichelt es naß über die gepeinigte Haut. Die Augen schließen und ausruhen. Für kurze Zeit den ausgedienten Unteroffizier vergessen. Schuhe aus! Füße baden, Gesicht und Hände waschen! In Zweierreihe aufstellen! Der Kommandoton des wanderstockschwingenden Riegenführers beendet das Wonnegefühl, bevor die Gänsehaut aus Wasser, Wind und Sonne zu wohligem Dösen werden kann und zu Wünschen nach weiterem, weicherem Streicheln. ………“Steigen Sie ein, ich fahr über die Phillippsruher Allee.“ Das Taxi wendete, die Autoschlange hinter ihnen hatte sich bereits nach rückwärts in die Seitenstraßen verkrochen. Die Linden an der leeren Frankfurter Landstraße mit der geschlossenen Schranke konnten aufatmen und für Minuten schienen die fünfziger Jahre tatsächlich zurückgekehrt.
Peter Kammer hatte seinen hellen Trenchcoat übergeworfen, die Reisetasche und das Case hinter sich unter die Laderampe ins Trockene gestellt. Um neunuhrdreißig, als er aus dem Taxi stieg, hatte er den Mantel nicht angezogen. Da schien die Sonne noch, nicht sonderlich klar, doch sie machte den Eindruck, als könne sie sich schnell gegen den Morgennebel über der Stadt durchsetzen.
Da hatte er zum ersten Mal echte Reiselust verspürt. Eine Fahrt ins Blaue würde es nicht werden – eher ins Ungewisse. Keine seiner üblichen Dienstreisen, auch keine Abenteuerreise. Die Grenzerfahrung reizte ihn, die geographisch-politische und die persönliche. Er wußte nicht genau, worauf er sich einließ. Aber das war in seinem Job nicht selten der Fall. Er war immun, man kannte ihn, er hatte international einen guten Ruf als Journalist und notfalls auch die „Schutzbriefe“ des Senders dabei. Außerdem waren die jeweiligen deutschen Botschaften stets darüber informiert, wo er sich gerade befand. Kammer liebte das Risiko – mit Rückversicherung.
Jetzt stand er im Nieselregen unter dem Wellblechvordach der Schweinehalle.
Er fing an, auf und abzugehen. Seine Schritte hinterließen immer neue regenbogenfarbene Flecken auf dem Asphalt, die sich verformten, ausbreiteten, wenn er die Füße aufsetzte und einschrumpften, wenn er die Füße hob. Kammer fand kindliches Gefallen an diesen Farbspielen. Er probierte Wiegeschritte, begann fast zu tanzen. Reinhard Mays Hymne auf den Frankfurter Flughafen pfiff ihm dabei durch die Zähne. Ohrwürmer überbrücken Zeitlöcher: „…eine Pfütze Kerosin schimmert wie ein Regenbogen…“ Dieses Camälion, dachte Kammer, vom sanften Rebellen auf der Burg Waldeck zum Minnesänger für die Startbahn West. Und er selbst? Wetterfühlige Grübelei.
Seinen Tänzelschritt fand er plötzlich kindisch. Er hielt inne.
Die ölige Feuchtigkeit kroch durch die Schuhsohlen über die Socken unter seine Kordhosen. Er zog sie etwas hoch, denn er befürchtete, sein Anzug könnte den penetranten Schlachtereigeruch aufsaugen und in den nächsten Tagen nicht mehr loswerden. Die Reiselust war verflogen.
Die Ausdünstungen des Schlachthofes, vermischt mit Kautschukindustriegerüchen, legten sich auf seine Lungen. Inversionswetterlage, schlapper Luftstrom aus Südost. Die Sonne heute morgen war trügerisch gewesen. Er sträubte sich gegen den Smog, gegen die schmierig-fahle Einfärbung seiner Umgebung. Nicht nur der Asphalt, auch die Wände der Schlachthofgebäude waren mit dem schmutzig grauen Film überzogen. Vielleicht lag es an seiner Brille?
Kammer nahm sie ab, griff reflexartig zur Brusttasche seines Anzuges nach dem obligatorisch orangefarbenen Taschentuch – Er griff ins Leere. Er hatte es in der Eile des Aufbruchs heute morgen vergessen einzustecken. In der Manteltasche fand er eine Packung Tempotaschentücher. Er hauchte die Brillengläser an, putzte sie sorgfältig und setzte die Brille wieder auf. Vergeblich. Er nahm die gegenüberliegenden Gebäude immer noch wahr wie durch eine Mattscheibe. Ohne die Brille erneut abzusetzen rieb sich Kammer die Augen. Doch auch jetzt blieb alles matt. Eine Mattigkeit, die seinen Gemütszustand belagerte.
Kammer merkte, wie in ihm ein eigenartiges Bedürfnis hochstieg. Seine rechte Hand klammerte sich in der Manteltasche um die Tempotaschentücher, Fensterputzen, Kachelnabspritzen, Hofkehren.
Zuhause hatte er den Hochdruckreiniger stehen… Vom Sockel runter ist gut, dachte er,Tiefebenen waren nicht anders zu erforschen, aber das hier ging zu weit. Er war nicht hierher gekommen, um sich im Hanauer Schlachthof einzurichten, obwohl… ..von den Augen her eroberte ein jugendlich wild-mildes Lächeln Kammers Gesicht, fragend, fordernd, herausfordernd … man könnte ja … Er dachte an den Frankfurter Schlachthof und spürte dabei wieder etwas Blut in seinen kalt gewordenen Füßen … Zwei Putzkolonnen, etwas Farbe, Kleinkunstbühne, Lippmann und Rau… „Jazz in der Schweinehalle“, das klang gut. ……..
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nach ihm waren die Steinbrüche für die kommunistischen/sozialdemokratischen Zwangsarbeiter aus den KZs benannt: Hermann-Göring-Werke zwischen gelnhausemn und Gießen, oberhalb von Breitenborn, bei Schlüchtern/Steinau, oberhalb von Wächtersbach: später hießen diese Hermann-Görimg-Werke nur noch Deutsche-Hartstein-Industrie und waren weiter in gräflich, baronlich und fürstlichem Besitz. von Goertz, von Riedesel, von Solms, von Isenburg-Büdingen, Wächtersbach, Meerholz usw… Pflastersteine, Schotter für die Auto-Rollbahnen nach Osten, Holz für die Schützengräben und die Baustellen am Westwall, am Nordwall und zu den Kommunisten hkamen dann an 1939 die Ost-Untermenschen, die Niederländer, die Belgier, die Ungarn, die Polen, die russischen Kreigsgefangegen vom STALG Wegscheide.
BILD-Abmahnungen ? das Bild HaBE ich geerbt, wer es kommerziell nutzt krieg von mir ne Abmahnung nicht unter 5.000,-€
Der weiße Stein vom Sichelsberg
oder
Warum der Nationalsozialistische Betriebsobmann der Hermann Göringwerke ,Wilhelm Löher, im Sichelsberger Steinbruch zu Tode kam und heute noch geehrt wird.
Eine Erzählung von mehreren Seiten
Der Willi hätte sich gefreut. Und wie!
Warum? Warum ?? Ei könne sie sisch des net denke! Manne drehte sich weg vom Tresen, zischte dabei durch die dritten Zähne ein verzweifeltes Tsss, das wegen der spalte zwischen Prothese und Oberkiefer zu einem Zweistimmigen Pfeifen mißriet. Er schüttelte den Kopf stapfte mit schweren Schritten Richtung Ausgang und warf die Arme in die Luft. Für einen Moment schien es als würden sie davon fliegen. Glücklicherweise hatte er vorher noch das halbvolle Bierglas abgestellt. Sein Gegenüber, jetzt sein Hinterüber, schaute ihm nach wie ein begossener Pudel. Er konnte es sich wirklich nicht denken, aber er mußte es wissen. Wenn nicht von ihm , von Manne Kadelbach, dann eben von den anderen im Dorf. Kadelbach wußte es am besten.
Kadelbach war mit LÖHER ZUSAMMEN IN DIE Schule gegangen, Kindergarten gab es nicht in Sichelsberg, damals, Heute Schon aber damals eben niicht. . Er hatte die Kirchen bücher, die Standesamtsunterlagen und die Schulstatistiken und Chroniken durchforstet und war auf Kadelbach gestoßen. Nachbarskinder, ein ganzer Haufen, Kleinkrauter-, Mondscheinbauernkinder, Schulkameraden, gemeinsame Konfirmation, gleichzeitige Mitgliedschaft in der Sozialistischen Arbeiterjugend, die er nicht verwechseln durfte mit der SDAJ, die wie die Kommunistische Partei in den 60ern das D nach Vorne verpasst bekam als Sicherheit, vermeintlich, vorgeblich, aber tatsächlich, weil es immer stärker eine deutsche Partei war und immer stärker wurde. Nicht immer stärker, die schwankte so um die o,8 bis 1,9 Prozent, sie wurde immer stärker deutsch, irgendein Zentralkommitee oder eine Expertengruppe bei einem ZK hatte nämlich festgestellt, dass der Internationalismus erst kommen kann, wenn der Nationalismus sich ausgetobt hat. Also Nationalkommitee Freies Deustchland, und Kameraden statt Genossen und so.
Das war aber ein ziemlich alter Hut,den gabs schon seit dem 40. Geburtstag Jossip Stalins oder war es der 40. Parteitag der KpdSU? Na ja, war auch nicht soooo wichtig.
Kadelbach jedenfalls war Mitlglied der SAJ gewesen, die war damals noch sozialdemokratisch wie ehedem die Falken, und Löher war damals mit ihm zusammen.
Kadelbach musste es wissen.
Sichelberg, warum hieß der Sichelberg, das war keine sehr alte Bezeichnung, früher, so hatte er im Sichelsberger Heimatmuseum herausgefunden, früher hieß diese frisch bepflanzte Platte Hoherberg.
Sichelberg wurde er erst nach der Schließung des Steinbruches genannt. Lag ja nahe. Nahe bei Sichelberg, auf der Gemarkung, und der ehemalige Berg sah tatsächlich aus wie eine Sichel, wie der Mond, dem man die unbeleuchteten Teile kurz vor Neumond einfach weg gesprengt hatte, weggegraben, -gehauen und -gekarrt
Dein Turm wird- mein Turm wurde schon abgerissen
KinderLiebeKinderTräume: Loukardis Gräfin zu Erbach-Fürstenau zum 60. Geburtstag
Loukardis stürzte 2005 im AFE-Turm in den Tod, mich stürzte 1968 ein Polizist mit Staatsgewalt vom Vordach des ZÜRICH-Hochhauses in eine lebenslängliche Schwerbehinderung. Nächste Woche wird nichts mehr an beide Türme erinnern. Schon 2008 war das Zürichhochhaus weg, als ich beim 40. Jahrestag im Februar vom Vordach eine Erinnerungslesung machen wollte. Als Ersatz habe ich sie vom Dach des GallusTheaters gemacht bei dessen 25. Geburtstag, in den Hof, in den die 1600 ZwangsarbeiterINNen im ADLER-WERKseigenen KZ-Katzbach blicken mussten, wenn sie es konnten und durften – bei fauligem Wasser und verschimmeltem Brot.
Gegen das Vergessen !!!!
Liebe Loukardis, liebe LouCandys, liebe Candy-Lou,
(oder Candy-Lou oder nur Candi oder Kardy, die wilde Försterstochter aus dem Barock-Försterhaus vor der Mümlingbrücke und der Rennaisance Schlossmühle nannte uns immer: “Kardy und Hardy”, wenn sie für uns mit einem leichten Anflug von Eifersucht ein Treffen organisierte . Doris Wild ? Schön, schön, schön war die Zeit, dort wo die Blumen blühn… der ganze Schlosspark ein Meer von Annemonen, Windröschen, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Hyazinthen, Narzissen, Osterglocken und alles Wild…. Und wir als Kinder – obwohl erz-evangelisch – immer bei den katholischen Prozessionen durch den Erbach-Fürstenauischen Park vorne weg Blumen streuen, die wir zusammen am Tag vorher heimlich gesammelt hatten oder erst in aller „Herrgotts-Frühe“ Und der Schlosspark-Gärtner hat immer so getan, als ob er uns nicht sähe. Und dann und wann hat er „aus Versehen“ die Hintertür zur Orangerie offen stehn lassen … Wer hat noch Mal das Lied vom Candy-Man gesungen ? Donovan ? Und wer hatte es wann auf mich umgetextet ?
( Lou, Candy, Kardy… klar waren das Deine Kose- und auch Tarn-Namen in den Mittsechzigern, wenn wir uns Mal treffen wollten, geschrieben haben, was in den Endsechzigern leider viel zu selten klappte *****)
es war immer eine schier unüberwindliche Mauer zwischen uns, doch wir haben es als Zweikäsehochs gepackt, wenn wir drei oder zwei davon aufeinanderstellten, dann konnten wir die Schlossparkmauer überwinden und uns im Unterholz auch finden. Du mit deiner ganz ungräflichen Lausbubenstimme, die in den späten 50ern schon so Alt klang wie meine, oder war das die deines Bruders ? Klar, wir haben uns mit ihm geprügelt oder waren es die Coussengs aus dem Hause Erbach-Erbach-Erbach-Leiningen und den Seinigen ? und erst in den 60ern, als wir schon nicht mehr dicht an der Schlossparkmauer wohnten, habe ich Dich und Deine Altstimme entdeckt. Dein Bruder oder wars Dein Vater ? alle haben sie Dich versteckt gehalten und nur selten haben wir uns gesehen. Hinten im Armenviertel bei der Einhardts-Basilika, und dem alten Kindergarten, kurz vor dem Farrentrapp.. da konnte ich Dich treffen und mit keinem Minenspiel verraten, dass ich Dich und niemand andren sonst treffen wollte. Da wars bereits so um die 66/67/68 und Du noch lange keine 18. Und ich schon soooo weit weg, geflohen, ausgewiesen aus den Weihrauch-Nebelfeldern der Mümling-(manchmal süßen Sünden-)Sümpfe, dem Mief von über 1000 Jahren unter den Talaren der Amtsrichter, Pfaffen & Grafen und Winkeladvokaten, der Kriegsgewinnler, der ZwangsarbeitswirtschaftswunderUnternehmerKinder, wir Outlaws, heimatvertreiben wie die vaterlandslosen Gesellen, die noch das letzte pflügbare Handtuch im Odenwald bei Bank und Adel eintauschen mussten gegen die Fron-Freiheit und Niedrig-Lohnarbeit im Stücklohn und Akkord-ist-Mord bei Pirelli, Merk, Röhm & Haas, Rowenta, Rexroth, Koziol, Dunlop und Casella.
Wir zwischen Zahnradbahn und Petronella auf dem AmiStraßen-Strich am Kiosk-Schwarz beim Opa von der Jessika, wo sich die OstWest und die Nordsüd-Bundesstraßen und eben nicht nur die so furchtbar fruchtbar kreuzten.
Ich habe Dich besungen von vor den Schlossparkmauern, trotzig auch ganz offen, wenn ich sie erklommen und etwas gesoffen hatte oder heimlich im Schlosshof, immer auf der Hut vor deinem Vater, “Es waren zwei Konigs-Kinder…” Das hatte nix mit Tom Königs zu tun und außerdem warst Du Grafen-Kind und ich nicht Mal das. Das konnte ja nix werden. Zumindest nicht auf Erden.
Dein Bild aus Kinder- und aus Jungend-Jahren bleibt mir in Herz und Kopf und Bauch….
und wenn ich heute lesen muss von Deinem Tod. und wie ihn dieses verFAZte Blatt FRmarktet … ich lass Dich nicht in unendliche Escher-Albträume versetzen. Du bleibst mein Kindertraum, meine Kinderliebe, mein Sturm und Drang für den ich desertieren wollte. Und es auch tat, Du warst zumindest auch ein Grund für mich, dem Bund die beiden Mittelfinger heldenhaft zu zeigen, um aus der Todes-Haft für ihre Kriege zu entkommen. Zu Viele haben sich und zu viel anderen in dieser mörderischen Massen-Haft das leben und die Lebenslust genommen. Du warst ein Teil der Kraft, die mich dort rausgeholt hat. Dafür möchte ich Dir heute noch und immer wieder danken.
Halt uns Oben einen Platz frei, wir haben noch so viel zu babbeln..
Ach ja, Du hast schon früh Deine “Gräfin zu” entschieden weit hinter Dir gelassen. Ich fand es schön, dass Du von Innen die Schlossparkmauer abgerissen hast.
Im “Damenschneider” habe ich seit vielen Jahren einen der besten Plätze für Dich reserviert. Dort haben wir uns regelmäßig in der Orangerie getroffen- im alten Spruchkammer-Nachfolge-Entnazifizierungskreis des aus den USA zurückgekehrten säkularisierten Juden Dr. Mömlinger, der sich zum AntiFa-Kreis weiter entwickelt hatte…
Also, Du hast den Platz im Roman, dafür hälst Du uns oben oder unten , auf jeden Fall drüben (eben dort, wo sie uns immer hinschicken wollten) die besten Plätze neben Dir frei!!
Ich werde alle Deine FreundINNeN von Dir grüßen, Deine Männer und Kinder auch ?
In alter Eifersucht und unzerbrechlicher Kinderliebe
Dein Hartmut
(*****Heyhey Hello Mary-Lou, das war das Lied aus dem ein Teil Deines Kosenamens stammte, ich glaube es war von den dänischen Kinderstars Jan und Kjelt und wir haben versucht, sie zu imitieren, bis wir die Little Banjo-Boys zu doof fanden und auf die Songs von Pete Seeger umgeschwenkt sind. Mit den ersten Versuchen einer Skiffel-Group im Odenwald, einer auf Banjo umgefriemelten Gitarre, dem Waschbrett aus der Waschküche der “Bauernschule”, und einem mit Butterbrotpapier überspannten Teekessel, der so als Saxophon diente, näturlich auch der Teekisten-Bass, den wir uns beim Bahnspediteur Nord organisert haben oder die ZigarrenKisten, Tabak-Kisten vom “Zigarren-Schöll” in der Hauptstraße kurz vorm Rathaus, neben der Gaststätte zur Krone und dem “Schwiegermutter-Brunnen”, gegenüber vom “KONSUM”, neben der Drogerie Rexroth, dem “Kaisers Kaffee” und schräg gegenüber vom Eisenwaren “Croissant”, der vor der Auswanderung der Hugenotten wahrscheinlich in Frankreich Bäcker war. Warum der dann Nägel und Schrauben gebacken hat, war uns als Kindern immer ein Rätsel, da half uns auch das Französisch meiner Mutter nicht besonders, oder das der Dorniaques, die die Kammfabrik betrieben hatten. Auch das vom Schuster Bischof aus Paris nicht, der nach 1918 Paris verlassen musste und so nach Steinbach kam )
DRINGEND NOT-WENDIGE VORBEMERKUNG (bevor es zum Ostereinmarsch in die Ukraine geht !?!?)
Recherchen zur Ukraine, zu B-H (((wo der EU-Gouverneur mit EinmaRSCH DROHT; WAS DER Ö-AUSSENKASPER von der ÖVP FÜR DIE uKRAINE IM GESTRIGEN zip (20.2.14)vorerst noch ausgeschlossen hat))) wie zu Hermann Josef Abs sind äußert schwierig. Sie hängen immer direkt mit den Niederkunfts-& Geburtslügen der Bundesrepublik – von der Kronberger Währungskonferenz bis zur Berliner Luftbrücke von des Reiches, der balkanischen Erweiterung, mit OstKornkammern & Ölquellen & Krimsekt zusammen.
Sie sind auch sehr teuer. So teuer, dass sie den Rechercheur in den Bankrott treiben. Dazu HaBE ich weiter unten Einiges geschrieben. Die jetzt wieder auf mich zukommenden Abmahn-Kosten kann ich mit meiner (Berufsverbots-bedingt-gekürzten) Rente alleine nicht schultern. Damit ich mein ABS-olut NonProfit Internet-Projekt weiter betreiben kann, bitte ich Sie/euch unter dem Kennwort “ABS-solution” um Spenden auf mein Konto Nr. 1140086 bei der VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen , BLZ: 506 616 39
Danke. HaBE))
GEGEN DAS VERGESSEN
Das Konzentrationslager in den Adlerwerken in Frankfurt am Main
22. März 1944 Ein Luftangriff führte zu schweren Zerstörungen in den Adlerwerken in Frankfurt am Main. In Folge dessen wurden die meisten Produktionszweige ins Umland verlagert und damit auch die Firmensubstanz über das Kriegsende hinaus gerettet. Schützenpanzerfahrgestell- und Motorenfertigung blieben in Frankfurt. Arbeitskräfte fehlten. »Nachschub« an Zwangsarbeiter/innen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Adlerwerke forderten beim SS-WVHA (Wirtschaftsverwaltungshauptamt) mit Nachdruck KZ-Häftlinge an. Sie sollten direkt am Arbeitsplatz untergebracht werden – mitten in der Stadt, im Gallusviertel, im dritten und vierten Stock des Fabrikgebäudes an der Weilburger Straße im Werk I. Eine schnell umzusetzende und billige Lösung. Um den Mangel an SS-Personal auszugleichen, stellten die Adlerwerke eine eigene, 300 Mann starke Hilfswachmannschaft zusammen, die mit der SS kooperierte. Die Organisation des Lagers wurde zwischen SS und Werk aufgeteilt.
Mitte August 1944 Lagerkommandant Franz traf in den Adlerwerken ein.
22. August 1944 Mit der Ankunft des Bauvorkommandos – 200 KZ-Häftinge aus Buchenwald – war das KZ Frankfurt/Adlerwerke, ein Aussenlager des KZ-Natzweiler, Deckname »Katzbach« eröffnet.
29. September 1944 Tausend KZ-Häftlinge kamen nach dreitägigem Transport aus Dachau in Frankfurt an. Anfang September hatte man sie aus dem aufständischen Warschau in das KZ Dachau verschleppt. Das Alter der Häftlinge lag zwischen 11 und 65 Jahren.
Ende Oktober 1944 Im KZ »Katzbach« waren 1139 Häftlinge – der höchste Belegungsstand des für 1000 Häftlinge konzipierten Lagers, das eine Fläche von höchstens 1300 qm hat. Insgesamt wurden mindestens 1600 Häftlinge in die Adlerwerke gebracht, für die die Adlerwerke einen geringen »Mietpreis« zahlten.
Jahreswechsel 1944/1945 Die Adlerwerke erzielten im Jahre 1944 den höchsten Bilanzgewinn während des 2. Weltkrieges.
8. Januar 1945 Mindestens 50 Häftlinge, die sich im Einsatz im Werk II befanden, starben bei einem Bombenangriff. Sie waren eingesperrt in einem Kellerraum, der nicht unter einem Gebäude, sondern unter einer Fahrstraße auf dem Werksgelände lag. Lagerkommandant Franz hatte untersagt, die Häftlinge in die Schutzbunker ins Werk I zu bringen.
Januar 1945 Im KZ gab es bereits 227 Tote; mindestens jeder sechste Häftling starb unmittelbar in den Adlerwerken. Die meisten kranken und arbeitsunfähigen Häftlinge wurden jedoch in das KZ Außenlager Vaihingen geschickt, faktisch ein Sterbelager. Das KZ Adlerwerke hatte die höchste Vernichtungsrate aller hessischen KZ Außenlager und aller Produktionskommandos des KZ-Stammlagers Natzweiler.
22. Januar 1945 Von ursprünglich 1200 Häftlingen befanden sich nur noch 744 im Lager. Der Januar 1945 war der Monat mit der höchsten Todesrate.
26. Januar 1945 In der Häftlingsstatistik wurden 167 »Zugänge« registriert. Die Häftlinge waren Warschauer, die wahrscheinlich alle vorher im KZ-Außenlager von Daimler-Benz in Mannheim-Sandhofen waren.
1. Februar 1945 225 Häftlinge aus Buchenwald kamen an. Der Transport setzte sich hauptsächlich aus langjährigen Häftlingen aus dem KZ-Außenlager Auschwitz-Jawischowitz zusammen. Mit ihnen kamen noch einige deutsche Häftlinge, die kurz zuvor aus Strafgefängnissen nach Buchenwald eingeliefert worden waren. Die bis dahin homogene Häftlingsgruppe war jetzt hierarchisch angelegt. Nach den wenigen »Reichsdeutschen« folgten die polnischen, russischen und jüdischen Häftlinge. Dazwischen gab es vereinzelt Häftlinge aus anderen Ländern. Acht Nationen waren im Lager vertreten.
12. März 1945 letzter Eintrag in der Häftlingsstatistik der Adlerwerke mit »Bestand«: 874.
13. März 1945 Ungefähr 500 sterbende, kranke und marschunfähige Häftlinge wurden in Güterwaggons gepfercht. Die SS verschloss sie, und drei Tage und Nächte standen sie auf den Gleisen bevor sich der Zug nach Bergen-Belsen in Bewegung setzte. Am 23. März 1945 erreichte er sein Ziel. Lediglich acht Häftlinge überlebten den Transport und das KZ Bergen-Belsen.
23. März 1945 Die Produktion im gesamten Werk stand still.
24. März 1945 Der Evakuierungsmarsch nach Buchenwald mit den restlichen etwa 400 Häftlingen begann. Am 30. März 1945 trafen dort 280 Häftlinge ein. Einige von ihnen überlebten in den Krankenblocks des KZ Buchenwald, andere wurden in weiteren Märschen in das KZ Dachau getrieben. Knapp 40 Häftlinge aus den Adlerwerken erreichten am 27.4.1945 das KZ Dachau und wurden dort zwei Tage später von der US-amerikanischen Armee befreit.
Rekonstruktion der “Putztruppen”: erste Versuche
WIR KENNEN DEN RUSSEN!!!
Ja das ist keine Aktion der israelischen Armee gegen Libanesische Raketenstellungen oder gegen die Schrottwerfer der Hamas in Gaza. Hier greift der RUSSE friedliebende Militärbasen und -Vettern der USA und der EU und der Nato an, sprengt Waffenlager in die friedliche Luft über Gori. Und von Süden können Zeugen schon die Ankunft einer Befreiungsarmada im Persischen Golf melden, die alles bisher Gesehene in den Schatten stellt. Golfkrieg 1.2.3.. das alles dürfen wir getrost vergessen: hier kommt was Neues, Großes und der Oberbefehlshaber soll McCain heißen, aber auch Obama-Bin-AfterBushsLaden wird Georgia on his mind haben müssen und sich in den persischen Apfel verbeißen.Gescheitert ist der Versuch, den obigen und diesen Beitrag mit Steinberg-Recherche und dem Hamburger Meta-Info zu verlinken. Wahrscheinlich habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Denn der Hinweis auf die Qualität der Mainstreammedia-Nachrichten aus ARD und ZDF und denen aus den Agenturen von dpa bis ap, kann ja nicht der Grund gewesen sein … oder ?PUTZTRUPPEN
(erster Rekonstruktionsversuch)
Es gab in Frankfurt eine Putztruppe schon lange vor Joschka Fischers Sandkasten-Version.
Die Geschichte dieser vor Fischer’schen Putztruppe ist ein Politthriller: Frankfurt erlebte zwischen 1920 und 1974 mehrere große Säuberungswellen: unter Noske, unter Hitler, unter der US-Militärregierung erst eine antifaschistische und dann gleich danach eine antikommunistische, die mit dem verbot der KPD nicht endete und 1968 und die folgenden bleiernen Jahre zu einer Säuberungssturmflut wurden. Informeller Chef der “Putztruppe” wie diese zuständige Abteilung beim 18. politischen Kommissariat genannt wurde, war der Haupt Kommissar Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh- auch als SchmutzFinkh gehänselt. 1973 wird Finkh erschlagen im Hinterhof einer besetzten Frankfurter Westendvilla gefunden. Ein Obdachloser sitzt dafür 10 Jahre, war es aber nicht.
Wer hat den Hauptkommissar Finkh ermordet und warum?
Nach einem Festplatten-Crash im PC des Autors muss er völlig neu geschrieben werden – der Politthriller über den 1927 in die väterlichen Fußstapfen bei der Frankfurter Kriminalpolizei stolpernden Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh und seine nach noskischen Säuberungseinsätze zur Reinigung des Frankfurter Nizza – des nördlichen Main-Ufers – auch am südlichen “Dribbdebach”, am Deutschherren-Ufer, das seinem Namen wieder alle Ehre machen soll. So wie die Damen von Welt und ihre Herren in Paris an der Seine promenieren, so sollen es die Gleichen auch in Frankfurt am Maine tun können. (Finkh spricht: an der Saine wie am Maine und er hätte so gerne aine von denen als die saine) Deshalb muss der Pöbel mitsamt den Wasserhäuschen verschwinden.
Aber das ist nur die Oberfläche.
Die Wasserhäuschen sind auch Treffpunkte und Nachrichtenbörsen, Geldsammelstellen für Kommunisten, Arbeitsscheue und andere Kleinkriminelle – neben den roten Zellen in der Brotfabrik und in Zeilsheim in der Farbwerkersiedlung, bei der Cassella, es sind Kommandozentralen der Wohngebietseinheiten des Rotfrontkämpferbundes, und nicht selten Verbrüderungsgeschwüre mit den vaterlandslosen Gesellen seiner eigenen Partei, die vor seinen Augen noch nach Feierabend im Riederwald um die Jösthäuschen wuchern. Da war die Eiserne Front fast eine Gläserne, so glasig wie die Augen nach der fünften Pulle..
Da stinkts nach Urinstein am Rinnstein
Frankfurt säubern!
Er wusste was das heißt: im Gymnasium -Bub, aus Dir soll mal was besseres werden!- da war Schmutzfink noch das harmloseste, was ihm die Schul-”Kameraden” nachriefen. Er roch als Kind eben wie ein Sozi so riecht – da konnte ihn die Mutter schrubben wie sie wollte, das machte es oft nur noch schlimmer nach den Schrubborgien roch er nach Kernseife und Sagrotan. “Bub, kämm dich, HAST DU DIE FINGERNÄGEL AUCH GEBÜRSTET ?” Es hat alles nichts genützt. Die kaum noch bezahlbaren Nachhilfestunden brachten ihn nicht so weit, dass er durch glänzende Leistungen und Bestnoten seinen Sozigeruch wettmachen konnte. Es kam dann eben doch alles zusammen: im Gagern-Gymnasium wollte sich niemand mehr neben ihn setzen, das Geld für die Nachhilfe wurde eingespart, und schließlich war er auch froh, dass er auf die Realschule wechseln konnte. Da konnte er alles aus dem FF, so wurde er begrüßt, bei Fritz Finkh war das so.
-der kanns aus dem FF !
Der gescheiterte Gagern Gymnasiast wurde zum Klassenbesten in der Realschule.
Und war immer blitzsauber. Und dann war er auch noch im Turnverein, nein nicht bei dene Juddebuuwe, bei der Eintracht, sondern im 2 fachen FF: im Frisch, fromm, fröhlich, freien Turnverein – und in der Tradition des Turnvaters Jahn. Der passte zu Finkh, und Finkh passte zu IHM. Rennen konnte er auch noch so toll: er war nicht nur Frisch, Fromm. Fröhlich und Frei, er war flink der Finkh wie ein Windhund und hart wie Kruppstahl und auch zäh, zäh wie Offenbacher Leder. Und die jungen Damen aus dem Elisabethen-Gymnasium im Westend, das war doch etwas ganz anderes als abgeroppte Dinger aus Fechenheim, aus dem Riederwald, aus dem Ostend. Ihm wurde ganz anders in der Magengegend, wenn er die Mädchen aus den der Ouarta, der Untertertia jetzt als höhere Töchter, als Damen der Gesellschaft mit den Herren Söhnen der Frankfurter Hautevolee am Nizza flanieren sah. Das war auch noch besser als die Bäcker- und Metzgertöchter, die das Gymnasium entweder gerade so schafften oder mit zwei Mal Sitzen- bleiben von der Schulbank weggeheiratet wurden – von Metzgern und Bäckern und besseren Kneipenwirten, Manche schafften es ja auch bis zur Hotelierfrau, aber dann war es meist Ende der Fahnenstange.. Die Garderobe war dementsprechend nicht Haut-Couture sondern von der Stange, . Französisch war weder sprachlich noch im Bett sein Ding: was er fließend beherrschte war Blümmo, Portmonnee, Schäßlong, Trottwar, auch Tollette, statt Scheißhaus ging ihm gut über die Lippen und jener Sachsenhäuser Warnruf für frühreife Metzgertöchterchen aus der Franzosenzeit: Machmer bloß kaa Fissematente!” Das wusste Willem schon als Ouartaner, als es mit der Quälerei mit dem Französisch losging: das hieß ursprünglich ”visiter ma tente” und war die Frage napoleonischer Offiziere, die in Sachsenhausen einquartiert waren also kurz vor Francfort – an die berühmten Sachsehäuser MetzjersTöschtersche: “Voulez vous visiter ma tente ce soir? “ (Möchten Sie heute Abend mein Zelt besuchen? )
Willem wollte die zerbrechlich aussehenden Bankiers Töchter, diese Engelsgesichter. Diese unerreichbaren hochgeschnürten Engelsbrüste. Diese guten Feen seiner Träume vor dem Schmutz und dem Bösen schützen, so wie das Vaterland und die deutsche Scholle vor Hunnen und Bolschewisten, wie Prinz Eugen einst Wien vor den Muselmanen. Oder wie der Johann-Sebastin Bch das geschriebenund komponiert hatte: C.A.F.F.E.E. trink nicht so viel Kaffee, nichts für Kinder ist der Türkentrank schwäcjht die Nerven, macht Dich schlapp und krank. Sei doch kein Muslemann, der das nicht lassen kann!“
Finkh wird wegen seiner guten Kenntnisse im Millieu der Kommunisten und der Frankfurter Kleinkriminellen -”das ist eh das gleiche Pack, die gleiche Mischpoke” – zu seinem Erstaunen von den Nazis nicht entlassen, nicht verhaftet – nein bruchlos übernommen, auf die neue Ordnung eingeschworen -und die konnten das auch ohne jeden Kompromiss durchziehen ! Frankfurt säubern !
1973 wird Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh im Hinter-Hof einer besetzten
Westendvilla erschlagen aufgefunden. Neben ihm ein Obdachloser mit einem
Wasserrohrstück in der einen und einer Flasche Fusel in der anderen Hand.
Das Rohr passte genau in die Delle auf dem Finkh’schen Kopf, das Rohr hatte
sich auch etwas aus der dünn gewordenen Finkh’schen Haarpracht mitgenommen
und mit echten Finkhenblut angeklebt. Die Sache war glasklar und der Obdachlose konnte auch nicht beweisen, dass er mit vier schluck aus der noch fast vollen Flasche bereits schuldunfähig alkoholvergiftet war. Nach 10 Jahren Preungesheim erhängt sich der arme Müll-Schlucker in seiner Zelle, hinterlässt nach 10 Jahren Tatleugnung nun doch noch ein “Bekennerschreiben”.
Das wiederum erweist sich bei erneuter Fahndung im Umfeld des Todesfalles Finkh als Fälschung: Wer hat den Finkh ermordet?
Finkh ist als “Widerständler” -weil er ja so viele SPD’ler und Gewerkschafter und auch Kommunisten und jüdische Familien retten konnte –na ja oft ging es halt partout nicht. Er war ja umgeben von echten Nazis und konnte auch nicht jede Familie retten, ermusste auch mal die eine oder andere ausliefern, einliefern, er musste auch SPD’ler und Kommunisten verhaften, sonsst wäre ich doch sofort aufgefallen und hätte dann niemand mehr retten können !- Finkh wird von der Militärregierung mit dem Aufbau der entnazifizierten demokratischen Frankfurter Kriminalpolizei beauftragt, liefert einerseits
gute bekannte an die Spruchkammer, liefert aber auch gegen Bares beste Persilscheine, kennt den Schwarzmarkt und den lieben Schieber Fritz Kietz, weiß wer später bei der Rosemarie im 190er saß und dann auf ihrem Schoß oder sie auf den immer noch furchtbar fruchtbaren absoluten Herrscherschößen .
Was ? Seit wann gebären hier die Männer ?
Das bleibt Frauensache – auch im Puff. Ach ja, seine Kneipe hinter der Katharinenkirche, die hatten ihm die Amis geschenkt, fürs erste nach dem verlorenen Krieg. Und da waren sie alle drin, der Ossi Büttner, der Emil und der andere Reichenstadt oder Mangelsdorf egal, Albert hieß der doch.
Der Finkh hat sich mit seiner nachnoskischen NaziPutztruppe ein Vermögen erpresst, hat jüdische Bürgerstöchterchen an Braune Goldfasane verkuppelt und dopppelt kassiert, bei den einen wegen der Rassenschande, bei den anderen wegen der benötigten Geldmittel und Goldmittel zur Beschaffung von gefälschten Papieren für die Flucht und für die Bestechung von Nazis und Mitläufern, Reichsbahn-Schaffnern, Reichsbahn-Polizei, Zug- und Unterscharführern bei der SS.
Eines der verkuppelten Mädchen ist die Mutter der zweiten Hauptfigur in dieser
Geschichte. Ihre Familie verspricht Finkh vor den Krematorien in Auschwitz zu retten. Sie opfert sich und macht die Beine breit für eine Frankfurter Nazigröße. Finkh lässt sie im Unklaren darüber, ob die Familie jetzt gerettet ist oder nicht . Er dringt darauf, dass sie aus Deutschland verschwindet. Über seine Kontakte zu den Gewerkschaftern von Untergrund-KPD und -SPD in Hamburg und bei der Reichsbahn kann sie ausgestattet mit falschen Papieren in Hamburg überleben und mit einem Brasilianischen Frachtschiff via Portugal und Südamerika die USA erreichen, wo sie in der Exilgemeinde von der Vernichtung ihrer gesamten Familie in Auschwitz erfährt.
Im Exil noch lernt sie den konfessionslos- sozialdemokratischen
Naturwissenschaftler Professor Schwarzmüller kennen, der nach dem Krieg
zurück nach Kiel kommt und dort die Universität mit wiederaufbaut. 1947 bringt sie ihren ersten Sohn zur Welt: Johannes Schwarzmüller.
Finkh hat in Frankfurt die Aufgaben im Vorfeld des Verbots der KPD recht gut gelöst. Er sieht zu, dass möglichst alle ausgeschaltet werden, die sein eindeutiges Doppelspiel durchschauen könnten oder durchschauen. Er gibt
den Kumpel und den Frühwarner bei Razzien sowohl in den Druckereien der KPD
als auch bei den Radfahren des Solidaritätsverbandes, bei den Kleinkriminellen in der Hasengasse, deren unterirdische Verbindungen zur Kleinen Bockenheimer er noch besser kennt als Emil Reichenstadt, der “Swinging Handkäs” im Jazzkeller. Er weiß auch wo die Gänge unter den ehemaligen Judenghetto in Richtung Fischerfeld führen und in welchen Kellern Ein- und Ausstiege zu finden sind. Einer dieser Ausgänge muss sich in einer Nische der Rauschgifthöhle namens “Aquarius” befinden.
Doch das war nicht sein Ding. Das Rauschgiftdezernat war für ihn nur eine Einstiegshilfe in eine Szene, deren Sprache er im Gegensatz zu seinem fast
angeborenen Proletenslang und SEINEM PARTEIKATECHISMEN-DEUTSCH nicht
ansatzweise beherrschte: er musste lesen lernen, da gab es von Bonn aus
Anweisungen, vom Generalbundesanwalt, vom LKA- Wiesbaden – Fortbildungskurse
auch bei Leuten aus dem fernen Pullach: Parteichinesisch, Psychologie,
Soziologie .. dafür wurden sogar Professoren extra von Köln nach Frankfurt
gescheucht in die Friedrich-Ebert-Anlage, um dort an Wochenenden ihm und
seinen Kollegen das nötige Vokabular für die “Neue Linke” beizubringen. Das
machten diese Professoren sogar im Doppelpack zusammen mit
Offiziersanwärtern der Bundeswehr: Staatsbürger in Uniform !
FRITZ MACHTE DAS SPIELCHEN MIT – ABER MIT GROLL IM BAUCH. KURZ VOR SEINER PENSIONIERUNG; SOLLTE ER SICH VON DIESEN SCHWÄTZERN NOCH SAGEN LASSEN; WOHIN DIE REISE ZU GEHEN HÄTTE: DER PROFESSOR SCHLAUCH TAT SEINEM NAMEN ALE EHRE UND SCHLAUCHTE; WAS DAS ZEUG HIELT:
Über mehrere Einsätze Finkh’s im neuen Millieu kommt der
Polizei Hauptkommissar in die WG des Erzählers Carlos und der zweiten
Hauptfigur Johannes Schwarzmüller. Dort gibt der grauhaarige Opa Funk den
guten Bullen, der sich nach der Razzia nach Dienstschluss noch Mal in der
WG meldet … er lässt seine Biografie der 30er Jahren etwas heraushängen – offenbart ansatzweise seine Zwiespältigkeit, und die jungen Leute gehen ihm zum Teil auf den Leim. Zum Teil. Es gibt neben vielen anderen Spaltlungen im Alltag der WG-Kommune- eine sogenannte Finkh-Spaltung. Die dritte Hauptfigur die Tochter eines Gerichtsreporters einer großen Frankfurter Tageszeitung mit linksliberalem Touch plädiert für die Umpolung- Umerziehung des geläuterten Polizisten und weist auf dessen Angebot hin, er wolle im Apparat etwas ändern, auch mal auf die Bremse treten, ihnen Infos zukommen lASSEN; EVENTUELL AUCH FRÜHWARNEN; WENN ER SICH DABEI NICHT SELBST GEFÄHRDET: ABER EIGENTLCIH — HABE ICH NIX MEHR ZU VERLIEREN: ICH GEH SO UND SO IN RENTE: ich hab ja grad noch 5 Jahre
Johannes scheint zu wissen, wer da in die Kommune infiltriert und plädiert
sehr zur >Überraschung der Hardliner in der WG für Christines Plan der “Umerziehung”
Die Putztruppe besteht selbstverständlich nicht nur aus Fritz Finkh -… er
hat noch drei Überlebende aus dem 1000jährigen zwar nicht unter seiner
Fuchtel, aber eben doch als Kollegen mit dabei und er hat sich neue Leute
herangezogen: Vogel, Klaus Vogel, genannt der Geier, nicht wegen dem Florian
Geyer – das würde schon hinhauen, denn Vogel kommt aus dem Vogelsberg und die
>Bauern dort waren schon immer etwas rebellisch, gerade jetzt, wo die
Frankfurter den Mondschein-Bäuerchen dort oben das Wasser klauten, da gab es
sie wieder, die Rebellen vom Vogelberg, nein Vogel, wurde deshalb Geier
genannt, weil er sein Opfer verhörte wie ein Aasgeier, der mit einer
Himmelsgeduld darauf warten konnte bis der letzte Lebensnerv aufgab, nein bei
ihm war es nichr der Lebensnerv, es war das Letzte sich sträuben, die
letzte Gegenwehr und er wusste, dass ein zu frühes Nachhacken nur
unbrechbare Widerstandskräfte mobilisieren würde. Vogel harrte aus, machte
den Freund und Helfer. Dabei gab es im Vogelberg weder Geier noch Adler,
doch Adler gab es, in Birstein gab es Zigeunersippen die hießen Adler,
die kannte er noch aus der Vorkriegszeit.
DA WURDEN DIE VON ÜBERALL IN OST UND OBERHESSEN NACH FRANKFURT ZUR GROßMARKTHALLE ZUSAMMENGETRIEBEN UND VON DORT WEITER IN DIE KZ’s NACH OSTEN:
Aber das waren nicht die Adler die Fritz meinte: Klaus Vogel war ein
absoluter Eintracht-Fan. Als er ihm einmal in den frühen 70ern in ihrer
Kneipe am Güterplatz die Geschichte mit den JuddeBuuwe erzählte, hätte Vogel
ihn bald erschlagen. Die Eintracht, ein jüdischer Verein? Das war gelogen !,
Aber diese Sache war schon einige Jahre alt. Bub ist der meist geschützte und
einer der meistgehassten Menschen in Bankrottfurt.
Motive für einen Finkhenmord haben viele der Menschen in dieser Geschichte:
es war schwierig, das erpresste Geld und Gold in Sicherheit zu bringen. Es
gab Nazis in der Schweiz und es gab Sozialdemokraten in der Schweiz und
KPDO’ler und SPD’ler im Schweizer Exil. Bei der Umgestaltung der Fahne hätte
man mit vier Strichen am weißen Kreuz auf rotem Grund aus dem Gelödschränkhli
schnell einen großdeutschen AlpenGau machen und die italienische Schweiz dem
>Duce schenken können wie einst die lustigen Tiroler.
Aber ein sicherer Geldschrank außerhalb der Reichsgrenzen damals und heute außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten der FINANZBEHÖRDEN; DER STAATSANWALTSCHAFT WAR SCHON BESSER als ein Konto auf der Frankfurter Sparkasse oder ein Depot bei Oppenheimer oder nur so unterm Kopfkissen.
Vier aus der Putztruppe wussten zumindest, dass Finkh das Vermögen in der
Schweiz untergebracht hatte, ob sie die Bank wussten und die
Zugangsmöglichkeiten hatten? Von den Vieren, wurden zwei nach dem Krieg als
Nazis vor die Spruchkammer gebracht und durften weiterhin Frankfurt nicht
mehr putzen. Die beiden „Entnazifizierungsopfer“, gründeten kurz nach der
Währungskonferenz, in Kronberg, mit Unterstützung aus einer Villa, eine mit
funkelnagelneuen BMW-Motorrädern ausgestattete Sicherheitsfirma, einen
Wachdienst und verdienten innerhalb eines Jahres das zehnfache ihres
ehemaligen Polizistengehaltes. Finkh nannte diesen persilscheinfreien
Karrieresprint nur bissig den “Quandtensprung”, ohne genau zu wissen, was
der denn tatsächlich in der Wissenschaft bedeutete: das war dann doch
manchmal ein Handykap mit nur der Mittleren- Reife. Mit einem Gaggern-Abitur
hätte er es gewusst. Pech ! Aber man kann halt nicht alles haben im Leben.
Pech für die beiden war, dass es schon auffiel, dass sie mit BMW-Motorrädern
arbeiteten, wo doch die Bad Homburger Konkurrenz Horex kostengünstiger und
auch noch besser war. Alt eingesessene persilweißgewaschene Firmen hatten
immer weniger Interesse Aufträge an ein Unternehmen zu geben, das im
Rhein-main-Gebiet als eine NaziFirma bekannt war und zudem auch noch von
Leuten angeschoben wurde, die in Nürnberg vor dem US-Ankläger gestanden
hatten. Das hatte zunächst auch negative Wirkungen auf die Auftragsbücher-
die öffentliche Hand , das rote Hessen, aber auch die US-Army vergaben
möglichst keine Aufträge an Unternehmen, die mit öffentlich bekannten Nazis
zusammenarbeiteten. Klar sah das schon in den frühen 50ern hinter den
Kulissen ganz anders aus. Man brauchte dann ja auch wieder solche Kerle hart
wie Kruppstahl, um Aufzuräumen ! Und Leute, die aus dem Schwarzmarkt auf den
Weltmarkt aufsteigen wollten, mussten sich Mitwisser und lästigen
Schmuddelkonkurrenz vom Hals halten oder schaffen. Und so kamen die
Kameraden von der Putztruppe doch wieder zusammen. Während die einen privat
nicht selten Mäuler knebelten und Hände fesselten waren den anderen da die
Hände gebunden durch Gesetze und andere Fesseln.
Es war eine gedeihliche Arbeitsteilung, ein eifriges Hin und herrichten zwischen Autobahnraststätten, Frankfurter Kreuzen ohne sichtbare Haken, Hafen und Flughafenbau bis hin zur U-Bahn und ein professionelles Hinwegsehen und ein- und Abgreifen.
Die weiteren mitspielenden Personen
Johannes Schwarzmüller,
der als Mitglied der Bewegung 2. Juni im August 1972 in Augsburg “auf der
Flucht” in Notwehr vermeintlich erschossen wird, tatsächlich handelt es sich
aber bei dem Erschossenen um Hannes’ Doppelgänger – Gerhard Albrecht, einen
Pfarrerssohn aus Neckarelz, der mit seinem Vater als 15 Jähriger nach
Karlsruhe zieht, wo der Vater eine Pfarrei übernehmen muss
Hannes ist derweilen vorübergehend im Ardeche-Tal untergetaucht und taucht jetzt
als Gerhard Albrecht mit dessen Papieren in Frankfurt wieder auf. Die
Identitätswechsel haben die beiden schon in der Schule abgesprochen und
eingesetzt, wo sie sich wegen ihrer Ähnlichkeit gegenseitig bei Prüfungen
vertreten konnten und sich auch bei der Bundeswehr den Dienst teilten.
Christine Plappert,
leidet nicht nur unter dem Familiennamen sondern auch unter dem Ruf ihres
Vaters, des berühmt-berüchtigten Frankfurter Gerichtsreportes, studiert
Soziologie und Psychologie, hospitiert nebenbei bei den Anthropologen/Völkerkundlern, die Umerzieherin des Herrn Finkh, hat
sowohl mit Hannes Schwarzmüller als auch mit Carlos Wunder ein Verhälnis,
das verhälnismäßig als für die 68er sehr lange hält, wobei sie nicht so genau
weiß ob sie jetzt Gerhard oder Hannes unter neben oder über sich hat. Aber
sie riecht es. Auch Carlos weiß, dass es eigentlich kein Dreiecksverhältnis
ist, sondern ein Vierecks …
Carlos Wunder-
ist weder mit Carlos Santana verwandt oder verschwägert, hat auch mit der
terroristenlegende Carlos nix zu tun, heißt eigentlich Karl Wunder und
wundert sich ab einem gewissen Punkt in seinem Leben über nix mehr.
John Goldstein-
ist der Sohn des US-amerikanischen Generalkonsuls in Frankfurt und Mitglied
bei den Unabhängigen sozialistischen Schülern in FFM
Luise Hamburger-
kommt aus der FNL in Wien- einer Strömung im kreuzbraven SÖS und befreit
zusammen mit Gudrun Ennslin, Anfdreas Baader, Holger meins und eine
ganze Legion von Kindern und Jugendlichen aus Erziehungsheimen so auch aus
dem Erziehungsheim Staffelberg
Leon Vatter,
der Initiator der ArbeitslosenSelbstHilfe, Kinobetreiber, Initiator von
Kinderläden und Selbstverwalteten Betrieben- ein nicht zu fassender
Querdenker und wie Finkh es ausdrückt: “ein Hans Dampf auf allen Gassen!”
Auch Finkh kriegt Vatter nicht zufassen.
Hans Metzger,
liebt die hohe Kunst der Arbeitsvermeidung und –Delegation, war schon immer
gerne Chef de Mission, Delegationsleiter und ließ immer gerne für sich
arbeiten. Entweder Geld oder Leute, sein Lieblingslied ist das von der
“Macht der Hiebe”, seine >Freundinnen tragen permanent Sonnenbrillen.
Mao,
ein Frankfurter ML-KampfKater, der einzige, der seinen vollen Namen sprechen
kann und bei Linienkämpfen in der WG eine wichtige Rolle spielt.
Trotzki,
ebenfalls Kampfkater aus einer der benachbarten Zentralen der 4.-
Internationalen,. Er lernt MAO im nahegelegenen Bethmannpark auf einer
Safari kennen. Das Anlegen von Vorräten ist ihm ein aus der roten Fibel verinnerlichte
Grundeigenschaft: er organisiert aus den umliegenden Häusern mit
italienisch-jugoslawischen Massenunterkünften jede Menge zum trocknen
aufgehängte Salami, die auch bei nur Teilrückgabe gegen besten Slibovicz und
oder original italienischen Rotwein einzutauschen ist. Endlich Urlaub vom
Billig Lambrusco von Penny, Albrecht, Levi und Co. Manchmal war das mit der
Bewusstseinserweiterung im eher traditionellen Stil zwar billiger und hatte
nicht so lange Folgewirkungen aber die Erweiterung bezog sich eher auf den
gefühlten Kopfumfang.
Der Vorratsbeschaffer war natürlich MAO , Trotzky fraß nur oder schrieb der
sich mit “I” ? Ich glaube , dieser Leo schrieb sich mit “i” am Schluss.
Der ganze Roman befindet sich auch nach dem Verlust des über 100 Seiten
umfassende unfertigen Manuskriptes als fertiger Film in meinem Kopf. Ich muss ihn
jetzt nur wieder auf die Festplatte bringen. Und das kann dauern.
James,
der vom Mossad/Schibeth verfolgte Sohn einer Tel Aviv-Amsterdamer Pelzhändlerin, die Auschwitz überlebt hat, und ihren Sohn gegen seinen Willen in die Israelische Armee bringen will
Josef Lewitzky,
Sohn der Auschwitzüberlebenden Hannia Lewitzky aus Lodz, die aus Polen noch
Israel auswandert und mit ihrem dort geborenen Sohn 1963 Israel fluchtartig
verlässt, weil sie den 6-Tage-Blitzkrieg kommen sieht und keine Menschen
mehr aus ihrer Heimat vertreiben will. Lodz war zweisprachig bevor es
Litzmannstadt wurde. Sie will unter Gleichberechtigten leben.
Dr. Anna Silberberg-
hat das Kinder- KZ- Lodz überlebt, musste mit ansehen, wie die Nazis die
Uniformfabrik in Lodz in Brandschossen, in der einige Hundert
KZ-ZwangsarbeiterINNEN eingesperrt waren, wenn diese noch Menschen als
brennende fackeln aus den Fenstern sprangen, um sich eventuell noch vor den
Flammen retten zu können, wurde das Gewehrfeuer auf sie eröffnet. Die in Reih und
Glied angetretenen Kinder aus dem Kinder- KZ wussten, dass ihre Eltern in
dieser Fabrik eingesperrt waren. Anna studierte Medizin und wurde in Polen
KinderKardiologin, sie saß bereits zwei Mal in Polen im Internierungslager:
einmal unter Gomulka und das zweite mal unter Jaruselski. Beide male musste
sie wieder entlassen werden, weil man sie als Herz-Spezialistin brauchte.
Johnny Pinke,
Prinz- Peter Altmann, war Chef der Kameruner Rocker, hat später Mal den Joseph Neckermann um eine Million oder waren es 7 erpresst.
Klint, der Sekretär der Kameruner,
Die Tochter des Frankfurter Polizeipräsidenten, der Messeturm und der
Hammer-Man, das Zürichhochhaus und Rosemarie Nitribitt
“Stalin”, der König der Frankfurter Unterwelt, auf dessen Beerdigung rund
15 Tausend Menschen den Sarg begleiteten. Ossi Büttner, Willi Münch, der “Flüsterwilli”, wegen seines Kehlkopfkrebses, Dr. Helene Schneider, die DFU-Frau, Erwin Karlsberg, der kommunistische FR- Redakteur und Befreier von Buchenwald, Hans Dunker, der kommunistische Druckereibesitzer in der Langen Straße, Jochen Pfahl, genannt die Fliege, der Schüler Funktionär, der sich gerne so kleidete wie seine Professoren, eine reihe anarchistischer und trotzkistischer und maoistischer Flüchtlinge aus Frankreich, und einer der nicht nach Frankreich zurück durfte,… aber da
sind alles nur Nebenrollen, wie auch die
Annette Kirsch,
die berüchtigte Frankfurter Schülerin, die Kondome propagierte,
Pillenquellen nannte und wegen ihrer ARTIKEL IN SCHÜLERZEITUNGEN UND IHRER
VORTRÄGE von der Bildzeitung als “SexKirsche” verschrieben wurde: “Sie lädt
ihre Schulkameraden zu Kirschen-Essen ein” “GruppenSex mit Kirsche und
Kondom” und ähnlich geschmackvolles Bei einer Aktion in Neu Isenburg gegen
einen Kinder Quäler in Gestalt eines Religionslehrers und Pfarrers Titelte
die Presse: “Sex-Kirsche lockt Kinder aus der Kirche!” ; “Statt Religion gibt’s Kirsche mit Kondom”, “Kirsche mit Kondom statt Gottesdienst im Dom” schrieb die Frankfurt-Ausgabe der Bildzeitung.
Es geht also ziemlich hoch her, nicht alles kommt in das Buch aber doch einiges und auch etliches, was ich hier nicht schreibe.
Und zum “Damenschneider” nur soviel: der heißt nicht so, weil er einige Damen
zerschnitten haben soll, er sollte mal ein echt eleganter Damenschneider werden, das hat er aber nicht geschafft. Er ist Flickschneider geworden , der Maximilian Meyer aus dem herzen des Odenwaldes, aus der deutschesten aller deutschen Kleinstädte: aus Michelstadt. Michel, was willst Du noch mehr, wobei Michel nicht der kleine aus Löneberga ist Michel heißt Groß und Statt heißt Siedlung, es muss sich also schon sehr früh um eine große Siedlung gehandelt haben — von wegen Kleinstadt. Eigentlich der Mittelpunkt der Welt, des Alls – wie Dr. Alsberg es immer brustbaritönig auch im
Biologieunterricht des städtischen Gymnasiums verkündete!
Alsberg war Heimathistoriker, Heimatkundler sagten die Nicht Akademiker ohne Schmiss.
Alsberg spielte eine wichtige Rolle in dieser Stadt und hatte nur einen kleinen aber feinen und eben nicht ungefährlichen Gegner: den aus dem Exil in den USA zurückgekehrten Historiker und von den Amerikanern eingesetzten Entnazifizierer Dr. Mömlinger. Mömlinger hatte jüdische Vorfahren, durfte in Frankfurt an der Johan-Wolfgang von Goethe-Universität nicht mehr lehren und forschen und floh noch vor 1939 in die USA.

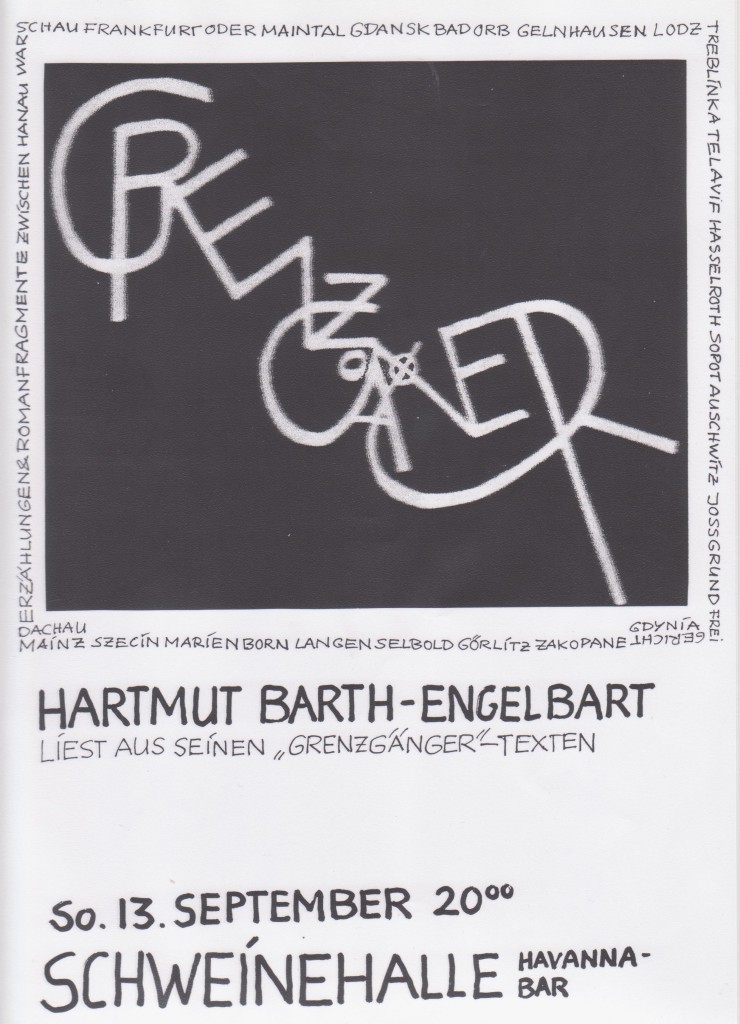

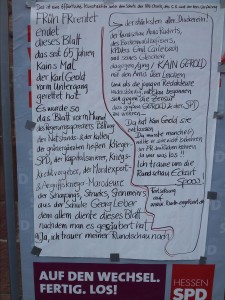







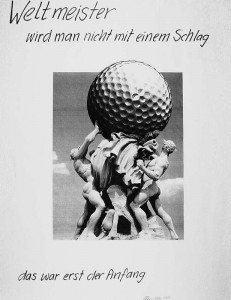







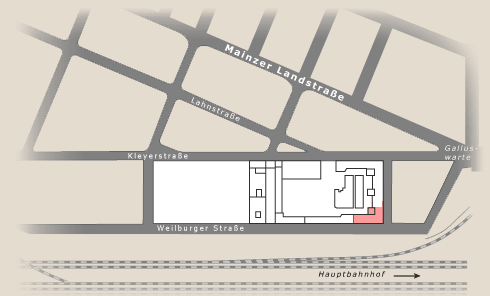
Hui buuhuuu,
schiet, ich dachte das wird erst abgecheckt und dann in der HP gekürzt eingestellt.
Tschuldigung Hartmut!
ali
hallo lieber Hartmut,
eine Frage an Dich hat dein Schreibprogramm keine Rechtschreibhilfe?
Ich lese eigentlich deine Berichte Gedichte und Geschichten recht gerne- jedoch in letzter Zeit wimmelt es in deinen Texten von Fehlern. (Also, wenn deine txt irgendwo rausfliegen ist das ev. ein Grund, also nur einer,-gelle?)
Ob das nun geht hab deinen txt etwas korrektur gelesen, ist in der Form bestimmt auch nicht Fehlerfrei, nur das schlimmste ist geändert, den Rest kann ein Volksschüler wie ich mit 68J nicht z.B Kongruenz & Überprüfung der Flexionsformen / — nun der txt
VORBEMERKUNG: schon wieder nach Tibet und Myanmar und Tibet und und und … drängt, nein – sprengt mich Kriegsvorbereitung und drohender globaler jetzt auch zunehmend militärischer Krieg weg vom Schreiben an meinen belletristischen und lyrischen Aufgaben. Kann ich in dieser Lage nicht anderes tun, als selbstmitleidend meine Festplatte und die Manuskripte versuchen zu retten: störe meine Kreise nicht . Kaukasische Kreise, kaukasische Greise, kaukasische Voll-Weise, und die Mainstreammedien schreiben und gehen über kaukasische blutverschmiert kreidebleiche Leichen . Statt über die Putztruppen sollte ich jetzt über die US-Schutztruppen schreiben, und die ukrainischen und die israelischen in BarCashWillis EUSA-stützpunkt Georgien, wo die prall mit Waffen gefüllten TransÜberfallMaschinen nur notdürftig in Humanmilitär-Wolldecken ge- & verhüllt sind: humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge hüstelt der ARD-Korrespondent und Hof- Kriegsberichterstatter Roth in die Kamera. während bewegte Bilder von russischen Panzern gezeigt werden, ja von auf Kameraleute schiessenden Bestien in russischer Uniform.
WIR KENNEN DEN RUSSEN!!!
Ja das ist keine Aktion der israelischen Armee gegen Libanesische Raketenstellungen oder gegen die Schrottwerfer der Hamas in Gaza. Hier greift der RUSSE friedliebende Militärbasen und -Vettern der USA und der EU und der Nato an, sprengt Waffenlager in die friedliche Luft über Gori. Und von Süden können Zeugen schon die Ankunft einer Befreiungsarmada im Persischen Golf melden, die alles bisher Gesehene in den Schatten stellt. Golfkrieg 1.2.3.. das alles dürfen wir getrost vergessen: hier kommt was Neues, Großes und der Oberbefehlshaber soll McCain heißen, aber auch Obama-Bin-AfterBushsLaden wird Georgia on his mind haben müssen und sich in den persischen Apfel verbeißen. Gescheitert ist der Versuch, den obigen und diesen Beitrag mit Steinberg-Recherche und dem Hamburger Meta-Info zu verlinken, wo er dann regelmäßig rausflog. Wahrscheinlich habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Denn der Hinweis auf die Qualität der Mainstreammedia-Nachrichten aus ARD und ZDF und denen aus den Agenturen von dpa bis ap, kann ja nicht der Grund gewesen sein … oder ?
Es gab in Frankfurt eine Putztruppe schon lange vor Joschka Fischers Sandkasten-Version
Die Geschichte dieser vor Fischer’schen Putztruppe ist ein Politthriller: Frankfurt erlebte zwischen 1920 und 1974 mehrere große Säuberungswellen: unter Noske, unter Hitler, unter der US-Militärregierung erst eine antifaschistische und dann gleich danach eine antikommunistische, die mit dem verbot der KPD nicht endete und 1968 und die folgenden bleiernen Jahre zu einer Säuberungssturmflut wurden. Informeller Chef der “Putztruppe” wie diese zuständige Abteilung beim 18. politischen Kommissariat genannt wurde, war der Haupt Kommissar Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh- auch als SchmutzFinkh gehänselt. 1973 wird Finkh erschlagen im Hinterhof einer besetzten Frankfurter Westendvilla gefunden. Ein Obdachloser sitzt dafür 10 Jahre, war es aber nicht. Wer hat den Hauptkommissar Finkh ermordet und warum?
Nach einem Festplatten-Crash im PC des Autors muss er völlig neu geschrieben werden – der Politthriller über den 1927 in die väterlichen Fußstapfen bei der Frankfurter Kriminalpolizei stolpernden Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh und seine nach noskischen Säuberungseinsätze zur Reinigung des Frankfurter Nizza – des nördlichen Main Ufers – auch am südlichen “Dribbdebach”, am Deutschherren-Ufer, das seinem Namen wieder alle Ehre machen soll. So wie die Damen von Welt und ihre Herren in Paris an der Seine promenieren so sollen es die Gleichen auch in Frankfurt am Maine tun können. (Finkh spricht: an der Saine wie am Maine und er hätte so gerne aine von denen als die saine) Deshalb muss der Pöbel mitsamt den Wasserhäuschen verschwinden.
Aber das ist nur die Oberfläche. Die Wasserhäuschen sind auch Treffpunkte und Nachrichtenbörsen, Geldsammelstellen für Kommunisten, Arbeitsscheue und andere Kleinkriminelle – neben den roten Zellen in der Brotfabrik und in Zeilsheim in der Farbwerkersiedlung, bei der Cassella, es sind Kommandozentralen der Wohngebietseinheiten des Rotfrontkämpferbundes, und nicht selten Verbrüderungsgeschwüre mit den vaterlandslosen Gesellen seiner eigenen Partei, die vor seinen Augen noch nach Feierabend im Riederwald um die Jösthäuschen wuchern.
Da stinkts nach Urinstein am Rinnstein
Frankfurt säubern! Er wusste was das heißt: im Gymnasium -Bub, aus Dir soll mal was besseres werden!- da war Schmutzfink noch das harmloseste, was ihm die Schul-”Kameraden” nachriefen. Er roch als Kind eben wie ein Sozi so riecht – da konnte ihn die Mutter schrubben wie sie wollte, das machte es oft nur noch schlimmer nach den Schrubborgien roch er nach Kernseife und Sagrotan. “Bub, kämm dich, HAST DU DIE FINGERNÄGEL AUCH GEBÜRSTET ?” Es hat alles nichts genützt. Die kaum noch bezahlbaren Nachhilfestunden brachten ihn nicht so weit, dass er durch glänzende Leistungen und Bestnoten seinen Sozigeruch wettmachen konnte. Es kam dann eben doch alles zusammen: im Gagern-Gymnasium wollte sich niemand mehr neben ihn setzen, das Geld für die Nachhilfe wurde eingespart, und schließlich war er auch froh, dass er auf die Realschule wechseln konnte. Da konnte er alles aus dem FF, so wurde er begrüßt, bei Fritz Finkh war das so.
-der kanns aus dem FF !
Der gescheiterte Gagern Gymnasiast wurde zum Klassenbesten in der Realschule.
Und war immer blitzsauber. Und dann war er auch noch im Turnverein, nein nicht bei dene Juddebuuwe, bei der Eintracht, sondern im 2 fachen FF: im Frisch, fromm, fröhlich, freien Turnverein – und in der Tradition des Turnvaters Jahn. Der passte zu Finkh, und Finkh passte zu IHM. Rennen konnte er auch noch so toll: er war nicht nur Frisch, Fromm. Fröhlich und Frei, er war flink der Finkh wie ein Windhund und hart wie Kruppstahl und auch zäh, zäh wie Offenbacher Leder. Und die jungen Damen aus dem Elisabethen-Gymnasium im Westend, das war doch etwas ganz anderes als abgeroppte Dinger aus Fechenheim, aus dem Riederwald, aus dem Ostend. Ihm wurde ganz anders in der Magengegend, wenn er die Mädchen aus den der Ouarta, der Untertertia jetzt als höhere Töchter, als Damen der Gesellschaft mit den Herren Söhnen der Frankfurter Hautevolee am Nizza flanieren sah. Das war auch noch besser als die Bäcker- und Metzgertöchter, die das Gymnasium entweder gerade so schafften oder mit zwei Mal Sitzen- bleiben von der Schulbank weggeheiratet wurden – von Metzgern und Bäckern und besseren Kneipenwirten, Manche schafften es ja auch bis zur Hotelierfrau, aber dann war es meist Ende der Fahnenstange.. Die Garderobe war dementsprechend nicht Haut-Couture sondern von der Stange, . Französisch war weder sprachlich noch im Bett sein Ding: was er fließend beherrschte war Blümmo, Portmonnee, Schäßlong, Trottwar, auch Tollette, statt Scheißhaus ging ihm gut über die Lippen und jener Sachsenhäuser Warnruf für frühreife Metzgertöchterchen aus der Franzosenzeit: Machmer bloß kaa Fissematente!” Das wusste Willem schon als Ouartaner, als es mit der Quälerei mit dem Französisch losging: das hieß ursprünglich ”visiter ma tente” und war die Frage napoleonischer Offiziere, die in Sachsenhausen einquartiert waren also kurz vor Francfort – an die berühmten Sachsehäuser MetzjersTöschtersche: “Voulez vous visiter ma tente ce soir? “ (Möchten Sie heute Abend mein Zelt besuchen? )
Willem wollte die zerbrechlich aussehenden Bankiers Töchter, diese Engelsgesichter. Diese unerreichbaren hochgeschnürten Engelsbrüste. Diese guten Feen seiner Träume vor dem Schmutz und dem Bösen schützen, so wie das Vaterland und die deutsche Scholle vor Hunnen und Bolschewisten, wie Prinz Eugen einst Wien vor den Muselmanen.
Finkh wird wegen seiner guten Kenntnisse im Millieu der Kommunisten und der Frankfurter Kleinkriminellen -”das ist eh das gleiche Pack, die gleiche Mischpoke” – zu seinem Erstaunen von den Nazis nicht entlassen, nicht verhaftet – nein bruchlos übernommen, auf die neue Ordnung eingeschworen -und die konnten das auch ohne jeden Kompromiss durchziehen ! Frankfurt säubern !
1973 wird Karl-Friedrich-Wilhelm Finkh im Hinter-Hof einer besetzten
Westendvilla erschlagen aufgefunden. Neben ihm ein Obdachloser mit einem
Wasserrohrstück in der einen und einer Flasche Fusel in der anderen Hand.
Das Rohr passte genau in die Delle auf dem Finkh’schen Kopf, das Rohr hatte
sich auch etwas aus der dünn gewordenen Finkh’schen Haarpracht mitgenommen
und mit echten Finkhenblut angeklebt. Die Sache war glasklar und der Obdachlose konnte auch nicht beweisen, dass er mit vier schluck aus der noch fast vollen Flasche bereits schuldunfähig alkoholvergiftet war. Nach 10 Jahren Preungesheim erhängt sich der arme Müll-Schlucker in seiner Zelle, hinterlässt nach 10 Jahren Tatleugnung nun doch noch ein “Bekennerschreiben”.
Das wiederum erweist sich bei erneuter Fahndung im Umfeld des Todesfalles Finkh als Fälschung: Wer hat den Finkh ermordet?
Finkh ist als “Widerständler” -weil er ja so viele SPD’ler und Gewerkschafter und auch Kommunisten und jüdische Familien retten konnte –na ja oft ging es halt partout nicht. Er war ja umgeben von echten Nazis und konnte auch nicht jede Familie retten, ermusste auch mal die eine oder andere ausliefern, einliefern, er musste auch SPD’ler und Kommunisten verhaften, sonsst wäre ich doch sofort aufgefallen und hätte dann niemand mehr retten können !- Finkh wird von der Militärregierung mit dem Aufbau der entnazifizierten demokratischen Frankfurter Kriminalpolizei beauftragt, liefert einerseits
gute bekannte an die Spruchkammer, liefert aber auch gegen Bares beste Persilscheine, kennt den Schwarzmarkt und den lieben Schieber Fritz Kietz, weiß wer später bei der Rosemarie im 190er saß und dann auf ihrem Schoß oder sie auf den immer noch furchtbar fruchtbaren absoluten Herrscherschößen .
Was ? Seit wann gebären hier die männer ?
Das bleibt Frauensache – auch im Puff. Ach ja seine Kneipe hinter der >Katharinenkirche, die hatten ihm die Amis geschenkt, fürs erste nach dem verlorenen Krieg. Und da waren sie alle drin, der Ossi Büttner, der Finkh hat sich mit seiner nachnoskischen NaziPutztruppe ein Vermögen erpresst, hat jüdische Bürgerstöchterchen an Brauns Goldfasane verkuppelt und dopppelt kassiert, bei den einen wegen der Rassenschande bei den anderen, wegen der benötigten Geldmittel und Goldmittel zur Beschaffung von gefälschten Papieren für die Flucht und für die Bestechung von Nazis und Mitläufern, Reichsbahn-Schaffner, -Zug- und Unterscharführern bei der SS
Eines der verkuppelten Mädchen ist die Mutter der zweite Hauptfigur in dieser
Geschichte. Ihr Familie verspricht Finkh vor den Krematorien in Auschwitz zu retten. Sie opfert sich und macht die Beine breit für eine Frankfurter Nazigröße. Finkh lässt sie im Unklaren darüber, ob die Familie jetzt gerettet ist oder nicht . Er dringt darauf, dass sie aus Deutschland verschwindet. Über seine Kontakte zu den Gewerkschaftern von Untergrund KPD und SPD in Hamburg und bei der Reichsbahn kann sie ausgestattet mit falschen Papieren in Hamburg überleben und mit einem Brasilianischen Frachtschiff via Südamerika die USA erreichen, wo sie in der Exilgemeinde von der Vernichtung ihrer gesamten Familie in Auschwitz erfährt.
Im Exil noch lernt sie den konfessionslos- sozialdemokratischen
Naturwissenschaftler Professor Schwarzmüller kennen, der nach dem Krieg
zurück nach Kiel kommt und dort die Universität mit wiederaufbaut. 1947 bringt sie ihren ersten Sohn zur Welt: Johannes Schwarzmüller.
Finkh hat in Frankfurt die Aufgaben im Vorfeld des Verbots der KPD recht gut gelöst. Er sieht zu, dass möglichst alle ausgeschaltet werden, die sein eindeutiges Doppelspiel durchschauen könnten oder durchschauen. Er gibt
den Kumpel und den Frühwarner bei Razzien sowohl in den Druckereien der KPD
als auch bei den Radfahren des Solidaritätsverbandes, bei den Kleinkriminellen in der Hasengasse, deren unterirdische Verbindungen zur Kleinen Bockenheimer er noch besser kennt als Emil Reichenstadt, der “Swinging Handkäs” im Jazzkeller. Er weiß auch wo die Gänge unter den ehemaligen Judenghetto in Richtung Fischerfeld führen und in welchen Kellern Ein- und Ausstiege zu finden sind. Einer dieser Ausgänge muss sich in einer Nische der Rauschgifthöhle namens “Aquarius” befinden.
Doch das war nicht sein Ding. Das Rauschgiftdezernat war für ihn nur eine Einstiegshilfe in eine Szene, deren Sprache er im Gegensatz zu seinem fast
angeborenen Proletenslang und SEINEM PARTEIKATECHISMEN-DEUTSCH nicht
ansatzweise beherrschte: er musste lesen lernen, da gab es von Bonn aus
Anweisungen, vom Generalbundesanwalt, vom LKA- Wiesbaden – Fortbildungskurse
auch bei Leuten aus dem fernen Pullach: Parteichinesisch, Psychologie,
Soziologie .. dafür wurden sogar Professoren extra von Köln nach Frankfurt
gescheucht in die Friedrich-Ebert-Anlage, um dort an Wochenenden ihm und
seinen Kollegen das nötige Vokabular für die “Neue Linke” beizubringen. Das
machten diese Professoren sogar im Doppelpack zusammen mit
Offiziersanwärtern der Bundeswehr: Staatsbürger in Uniform !
FRITZ MACHTE DAS SPIELCHEN MIT – ABER MIT GROLL IM BAUCH. KURZ VOR SEINER PENSIONIERUNG; SOLLTE ER SICH VON DIESEN SCHWÄTZERN NOCH SAGEN LASSEN; WOHIN DIE REISE ZU GEHEN HÄTTE: DER PROFESSOR SCHLAUCH TAT SEINEM NAMEN ALE EHRE UND SCHLAUCHTE; WAS DAS ZEUG HIELT:
Über mehrere Einsätze Finkh’s im neuen Millieu kommt der
Polizei Hauptkommissar in die WG des Erzählers Carlos und der zweiten
Hauptfigur Johannes Schwarzmüller. Dort gibt der grauhaarige Opa Funk den
guten Bullen, der sich nach der Razzia nach Dienstschluss noch Mal in der
WG meldet … er lässt seine Biografie der 30er Jahren etwas heraushängen – offenbart ansatzweise seine Zwiespältigkeit, und die jungen Leute gehen ihm zum Teil auf den Leim. Zum Teil. Es gibt neben vielen anderen Spaltlungen im Alltag der WG-Kommune- eine sogenannte Finkh-Spaltung. Die dritte Hauptfigur die Tochter eines Gerichtsreporters einer großen Frankfurter Tageszeitung mit linksliberalem Touch plädiert für die Umpolung- Umerziehung des geläuterten Polizisten und weist auf dessen Angebot hin, er wolle im Apparat etwas ändern, auch mal auf die Bremse treten, ihnen Infos zukommen lASSEN; EVENTUELL AUCH FRÜHWARNEN; WENN ER SICH DABEI NICHT SELBST GEFÄHRDET: ABER EIGENTLCIH — HABE ICH NIX MEHR ZU VERLIEREN: ICH GEH SO UND SO IN RENTE: ich hab ja grad noch 5 Jahre
Johannes scheint zu wissen, wer da in die Kommune infiltriert und plädiert
sehr zur >Überraschung der Hardliner in der WG für Christines Plan der “Umerziehung”
Die Putztruppe besteht selbstverständlich nicht nur aus Fritz Finkh -… er
hat noch drei Überlebende aus dem 1000jährigen zwar nicht unter seiner
Fuchtel, aber eben doch als Kollegen mit dabei und er hat sich neue Leute
herangezogen: Vogel, Klaus Vogel, genannt der Geier, nicht wegen dem Florian
Geyer – das würde schon hinhauen, denn Vogel kommt aus dem Vogelsberg und die
>Bauern dort waren schon immer etwas rebellisch, gerade jetzt, wo die
Frankfurter den Mondschein-Bäuerchen dort oben das Wasser klauten, da gab es
sie wieder, die Rebellen vom Vogelberg, nein Vogel, wurde deshalb Geier
genannt, weil er sein Opfer verhörte wie ein Aasgeier, der mit einer
Himmelsgeduld darauf warten konnte bis der letzte Lebensnerv aufgab, nein bei
ihm war es nichr der Lebensnerv, es war das Letzte sich sträuben, die
letzte Gegenwehr und er wusste, dass ein zu frühes Nachhacken nur
unbrechbare Widerstandskräfte mobilisieren würde. Vogel harrte aus, machte
den Freund und Helfer. Dabei gab es im Vogelberg weder Geier noch Adler,
doch Adler gab es, in Birstein gab es Zigeunersippen die hießen Adler,
die kannte er noch aus der Vorkriegszeit.
DA WURDEN DIE VON ÜBERALL IN OST UND OBERHESSEN NACH FRANKFURT ZUR GROßMARKTHALLE ZUSAMMENGETRIEBEN UND VON DORT WEITER IN DIE KZ’s NACH OSTEN:
Aber das waren nicht die Adler die Fritz meinte: Klaus Vogel war ein
absoluter Eintracht-Fan. Als er ihm einmal in den frühen 70ern in ihrer
Kneipe am Güterplatz die Geschichte mit den JuddeBuuwe erzählte, hätte Vogel
ihn bald erschlagen. Die Eintracht, ein jüdischer Verein? Das war gelogen !,
Aber diese Sache war schon einige Jahre alt. Bub ist der meist geschützte und
einer der meistgehassten Menschen in Bankrottfurt.
Motive für einen Finkhenmord haben viele der Menschen in dieser Geschichte:
es war schwierig, das erpresste Geld und Gold in Sicherheit zu bringen. Es
gab Nazis in der Schweiz und es gab Sozialdemokraten in der Schweiz und
KPDO’ler und SPD’ler im Schweizer Exil. Bei der Umgestaltung der Fahne hätte
man mit vier Strichen am weißen Kreuz auf rotem Grund aus dem Gelödschränkhli
schnell einen großdeutschen AlpenGau machen und die italienische Schweiz dem
>Duce schenken können wie einst die lustigen Tiroler.
Aber ein sicherer Geldschrank außerhalb der Reichsgrenzen damals und heute außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten der FINANZBEHÖRDEN; DER STAATSANWALTSCHAFT WAR SCHON BESSER als ein Konto auf der Frankfurter Sparkasse oder ein Depot bei Oppenheimer oder nur so unterm Kopfkissen.
Vier aus der Putztruppe wussten zumindest, dass Finkh das Vermögen in der
Schweiz untergebracht hatte, ob sie die Bank wussten und die
Zugangsmöglichkeiten hatten? Von den Vieren, wurden zwei nach dem Krieg als
Nazis vor die Spruchkammer gebracht und durften weiterhin Frankfurt nicht
mehr putzen. Die beiden „Entnazifizierungsopfer“, gründeten kurz nach der
Währungskonferenz, in Kronberg, mit Unterstützung aus einer Villa, eine mit
funkelnagelneuen BMW-Motorrädern ausgestattete Sicherheitsfirma, einen
Wachdienst und verdienten innerhalb eines Jahres das zehnfache ihres
ehemaligen Polizistengehaltes. Finkh nannte diesen persilscheinfreien
Karrieresprint nur bissig den “Quandtensprung”, ohne genau zu wissen, was
der denn tatsächlich in der Wissenschaft bedeutete: das war dann doch
manchmal ein Handykap mit nur der Mittleren- Reife. Mit einem Gaggern-Abitur
hätte er es gewusst. Pech ! Aber man kann halt nicht alles haben im Leben.
Pech für die beiden war, dass es schon auffiel, dass sie mit BMW-Motorrädern
arbeiteten, wo doch die Bad Homburger Konkurrenz Horex kostengünstiger und
auch noch besser war. Alt eingesessene persilweißgewaschene Firmen hatten
immer weniger Interesse Aufträge an ein Unternehmen zu geben, das im
Rhein-main-Gebiet als eine NaziFirma bekannt war und zudem auch noch von
Leuten angeschoben wurde, die in Nürnberg vor dem US-Ankläger gestanden
hatten. Das hatte zunächst auch negative Wirkungen auf die Auftragsbücher-
die öffentliche Hand , das rote Hessen, aber auch die US-Army vergaben
möglichst keine Aufträge an Unternehmen, die mit öffentlich bekannten Nazis
zusammenarbeiteten. Klar sah das schon in den frühen 50ern hinter den
Kulissen ganz anders aus. Man brauchte dann ja auch wieder solche Kerle hart
wie Kruppstahl, um Aufzuräumen ! Und Leute, die aus dem Schwarzmarkt auf den
Weltmarkt aufsteigen wollten, mussten sich Mitwisser und lästigen
Schmuddelkonkurrenz vom Hals halten oder schaffen. Und so kamen die
Kameraden von der Putztruppe doch wieder zusammen. Während die einen privat
nicht selten Mäuler knebelten und Hände fesselten waren den anderen da die
Hände gebunden durch Gesetze und andere Fesseln.
Es war eine gedeihliche Arbeitsteilung, ein eifriges Hin und herrichten zwischen Autobahnraststätten, Frankfurter Kreuzen ohne sichtbare Haken, Hafen und Flughafenbau bis hin zur U-Bahn und ein professionelles Hinwegsehen und ein- und Abgreifen.
Die weiteren mitspielenden Personen
Johannes Schwarzmüller,
der als Mitglied der Bewegung 2. Juni im August 1972 in Augsburg “auf der
Flucht” in Notwehr vermeintlich erschossen wird, tatsächlich handelt es sich
aber bei dem Erschossenen um Hannes’ Doppelgänger – Gerhard Albrecht, einen
Pfarrerssohn aus Neckarelz, der mit seinem Vater als 15 Jähriger nach
Karlsruhe zieht, wo der Vater eine Pfarrei übernehmen muss
Hannes ist derweilen vorübergehend im Ardeche-Tal untergetaucht und taucht jetzt
als Gerhard Albrecht mit dessen Papieren in Frankfurt wieder auf. Die
Identitätswechsel haben die beiden schon in der Schule abgesprochen und
eingesetzt, wo sie sich wegen ihrer Ähnlichkeit gegenseitig bei Prüfungen
vertreten konnten und sich auch bei der Bundeswehr den Dienst teilten.
Christine Plappert,
leidet nicht nur unter dem Familiennamen sondern auch unter dem Ruf ihres
Vaters, des berühmt-berüchtigten Frankfurter Gerichtsreportes, studiert
Soziologie und Psychologie, hospitiert nebenbei bei den Anthropologen/Völkerkundlern, die Umerzieherin des Herrn Finkh, hat
sowohl mit Hannes Schwarzmüller als auch mit Carlos Wunder ein Verhälnis,
das verhälnismäßig als für die 68er sehr lange hält, wobei sie nicht so genau
weiß ob sie jetzt Gerhard oder Hannes unter neben oder über sich hat. Aber
sie riecht es. Auch Carlos weiß, dass es eigentlich kein Dreiecksverhältnis
ist, sondern ein Vierecks …
Carlos Wunder-
ist weder mit Carlos Santana verwandt oder verschwägert, hat auch mit der
terroristenlegende Carlos nix zu tun, heißt eigentlich Karl Wunder und
wundert sich ab einem gewissen Punkt in seinem Leben über nix mehr.
John Goldstein-
ist der Sohn des US-amerikanischen Generalkonsuls in Frankfurt und Mitglied
bei den Unabhängigen sozialistischen Schülern in FFM
Luise Hamburger-
kommt aus der FNL in Wien- einer Strömung im kreuzbraven SÖS und befreit
zusammen mit Gudrun Ennslin, Anfdreas Baader, Holger meins und eine
ganze Legion von Kindern und Jugendlichen aus Erziehungsheimen so auch aus
dem Erziehungsheim Staffelberg
Leon Vatter,
der Initiator der ArbeitslosenSelbstHilfe, Kinobetreiber, Initiator von
Kinderläden und Selbstverwalteten Betrieben- ein nicht zu fassender
Querdenker und wie Finkh es ausdrückt: “ein Hans Dampf auf allen Gassen!”
Auch Finkh kriegt Vatter nicht zufassen.
Hans Metzger,
liebt die hohe Kunst der Arbeitsvermeidung und –Delegation, war schon immer
gerne Chef de Mission, Delegationsleiter und ließ immer gerne für sich
arbeiten. Entweder Geld oder Leute, sein Lieblingslied ist das von der
“Macht der Hiebe”, seine >Freundinnen tragen permanent Sonnenbrillen.
Mao,
ein Frankfurter ML-KampfKater, der einzige, der seinen vollen Namen sprechen
kann und bei Linienkämpfen in der WG eine wichtige Rolle spielt.
Trotzki,
ebenfalls Kampfkater aus einer der benachbarten Zentralen der 4.-
Internationalen,. Er lernt MAO im nahegelegenen Bethmannpark auf einer
Safari kennen. Das Anlegen von Vorräten ist ihm ein aus der roten Fibel verinnerlichte
Grundeigenschaft: er organisiert aus den umliegenden Häusern mit
italienisch-jugoslawischen Massenunterkünften jede Menge zum trocknen
aufgehängte Salami, die auch bei nur Teilrückgabe gegen besten Slibovicz und
oder original italienischen Rotwein einzutauschen ist. Endlich Urlaub vom
Billig Lambrusco von Penny, Albrecht, Levi und Co. Manchmal war das mit der
Bewusstseinserweiterung im eher traditionellen Stil zwar billiger und hatte
nicht so lange Folgewirkungen aber die Erweiterung bezog sich eher auf den
gefühlten Kopfumfang.
Der Vorratsbeschaffer war natürlich MAO , Trotzky fraß nur oder schrieb der
sich mit “I” ? Ich glaube , dieser Leo schrieb sich mit “i” am Schluss.
Der ganze Roman befindet sich auch nach dem Verlust des über 100 Seiten
umfassende unfertigen Manuskriptes als fertiger Film in meinem Kopf. Ich muss ihn
jetzt nur wieder auf die Festplatte bringen. Und das kann dauern.
James,
der vom Mossad/Schibeth verfolgte Sohn einer Tel Aviv-Amsterdamer Pelzhändlerin, die Auschwitz überlebt hat, und ihren Sohn gegen seinen Willen in die Israelische Armee bringen will
Josef Lewitzky,
Sohn der Auschwitzüberlebenden Hannia Lewitzky aus Lodz, die aus Polen noch
Israel auswandert und mit ihrem dort geborenen Sohn 1963 Israel fluchtartig
verlässt, weil sie den 6-Tage-Blitzkrieg kommen sieht und keine Menschen
mehr aus ihrer Heimat vertreiben will. Lodz war zweisprachig bevor es
Litzmannstadt wurde. Sie will unter Gleichberechtigten leben.
Dr. Anna Silberberg-
hat das Kinder- KZ- Lodz überlebt, musste mit ansehen, wie die Nazis die
Uniformfabrik in Lodz in Brandschossen, in der einige Hundert
KZ-ZwangsarbeiterINNEN eingesperrt waren, wenn diese noch Menschen als
brennende fackeln aus den Fenstern sprangen, um sich eventuell noch vor den
Flammen retten zu können, wurde das Gewehrfeuer auf sie eröffnet. Die in Reih und
Glied angetretenen Kinder aus dem Kinder- KZ wussten, dass ihre Eltern in
dieser Fabrik eingesperrt waren. Anna studierte Medizin und wurde in Polen
KinderKardiologin, sie saß bereits zwei Mal in Polen im Internierungslager:
einmal unter Gomulka und das zweite mal unter Jaruselski. Beide male musste
sie wieder entlassen werden, weil man sie als Herz-Spezialistin brauchte.
Johnny Pinke,
Prinz- Peter Altmann, war Chef der Kameruner Rocker, hat später Mal den Joseph Neckermann um eine Million oder waren es 7 erpresst.
Klint, der Sekretär der Kameruner,
Die Tochter des Frankfurter Polizeipräsidenten, der Messeturm und der
Hammer-Man, das Zürichhochhaus und Rosemarie Nitribitt
“Stalin”, der König der Frankfurter Unterwelt, auf dessen Beerdigung rund
15 Tausend Menschen den Sarg begleiteten. Ossi Büttner, Willi Münch, der “Flüsterwilli”, wegen seines Kehlkopfkrebses, Dr. Helene Schneider, die DFU-Frau, Erwin Karlsberg, der kommunistische FR- Redakteur und Befreier von Buchenwald, Hans Dunker, der kommunistische Druckereibesitzer in der Langen Straße, Jochen Pfahl, genannt die Fliege, der Schüler Funktionär, der sich gerne so kleidete wie seine Professoren, eine reihe anarchistischer und trotzkistischer und maoistischer Flüchtlinge aus Frankreich, und einer der nicht nach Frankreich zurück durfte,… aber da
sind alles nur Nebenrollen, wie auch die
Annette Kirsch,
die berüchtigte Frankfurter Schülerin, die Kondome propagierte,
Pillenquellen nannte und wegen ihrer ARTIKEL IN SCHÜLERZEITUNGEN UND IHRER
VORTRÄGE von der Bildzeitung als “SexKirsche” verschrieben wurde: “Sie lädt
ihre Schulkameraden zu Kirschen-Essen ein” “GruppenSex mit Kirsche und
Kondom” und ähnlich geschmackvolles Bei einer Aktion in Neu Isenburg gegen
einen Kinder Quäler in Gestalt eines Religionslehrers und Pfarrers Titelte
die Presse: “Sex-Kirsche lockt Kinder aus der Kirche!” ; “Statt Religion gibt’s Kirsche mit Kondom”, “Kirsche mit Kondom statt Gottesdienst im Dom” schrieb die Frankfurt-Ausgabe der Bildzeitung.
Es geht also ziemlich hoch her, nicht alles kommt in das Buch aber doch einiges und auch etliches, was ich hier nicht schreibe.
Und zum “Damenschneider” nur soviel: der heißt nicht so, weil er einige Damen
zerschnitten haben soll, er sollte mal ein echt eleganter Damenschneider werden, das hat er aber nicht geschafft. Er ist Flickschneider geworden , der Maximilian Meyer aus dem herzen des Odenwaldes, aus der deutschesten aller deutschen Kleinstädte: aus Michelstadt. Michel, was willst Du noch mehr, wobei Michel nicht der kleine aus Löneberga ist Michel heißt Groß und Statt heißt Siedlung, es muss sich also schon sehr früh um eine große Siedlung gehandelt haben — von wegen Kleinstadt. Eigentlich der Mittelpunkt der Welt, des Alls – wie Dr. Alsberg es immer brustbaritönig auch im
Biologieunterricht des städtischen Gymnasiums verkündete!
Alsberg war Heimathistoriker, Heimatkundler sagten die Nicht Akademiker ohne Schmiss.
Alsberg spielte eine wichtige Rolle in dieser Stadt und hatte nur einen kleinen aber feinen und eben nicht ungefährlichen Gegner: den aus dem Exil in den USA zurückgekehrten Historiker und von den Amerikanern eingesetzten Entnazifizierer Dr. Mömlinger. Mömlinger hatte jüdische Vorfahren, durfte in Frankfurt an der Johan-Wolfgang von Goethe-Universität nicht mehr lehren und forschen und floh noch vor 1939 in die USA.
HaBE “High-Matt-Lieder &-Geschichte(n)” & andere Lieder-& Lesungsangebote
z.B. den Roman “Onkelmord” um Paul Gaethgens, den Verbindungsoffizier zwischen Mussolini und dem “Führerhauptquartier”, der wegen Sabotage des u.a. von Thor Heyerdahl geleiteten norwegischen Widerstands am 6.11.1944 bei Trondheim abstürzt – zusammen mit weiteren Offizieren, hochrangigen Ingenieuren und Wissenschaftlern der Organisation “Todt” … Bilder von der Absturzstelle, Wrackteile der JU-52
Liebe hessische LiteraturfreudINNeN, liebe LIT-KollegINNen, liebe KollegINNen in Buchhandlungen und Büchereien, Schulen, Jugendzentren und Kitas,
liebe FreidenkerINNEN, arbeiterfotografinnen, Falken und Fälkinnen, Naturfreundinnen, linke Redaktionen , DFG-VKlerINNEN, VVN/BdAlerINNEN, attacies, BLOCKUPYerINNEN, GEWerkschafterINNEN und Parteileichen und wen ich sonst noch vergessen habe ….
neben dem aktuellen „High-Matt-Lieder- & Geschichte(n)“-Programm ***(siehe Fußnote)
möchte ich allen hessischen (aber auch „ausländischen”) Literatur-Initiativen, -Häusern, Kultur-&Jugendzentren, Schulen und Kitas, Krankenhäusern, Alten- & Studentenwohnheimen, Handwerks- und landwirtschaftlichen Kooperativen , MehrGenerationen-Wohnprojekten und öko-politischen Initiativen, Gewerkschaften, VL-Körpern und Betriebsräten (Buchhandlungen so und so) meine Kinder- & Jugendlichen- und „Erwachsenen“ – Lesungskonzert-Programme anbieten:
für Kinder ab 6 bis 10 ein Programm um die Ziege ZORA
um den Jung-Hanauer Enrico, der keine Liebesbriefe schreibt und um Funny und ihre Salzdiebinnen in Wien,
ein Programm für Kinder & Jugendliche ab 8 bis 14
Die ungekrönte Queen der Ladendiebinnen, Funny, die mit ihrer Mädchenbande vom Ladendiebstahl in Parfümerien wie LANCASTER auf den Verkauf von „Steinzeit-Salz“ und „Steinzeit-Steinen“ an amerikanische, japanische, chinesische Touristen mit anfänglich gutem Erfolg am Stephansdom umstellt, bis sie im Natur-Historischen Museum von Wärtern beim Salzklauen erwischt werden…. Natürlich kommt die Umstellung nicht nur aus der Überlegung, dass die Bande mit der Hehlerei Kids aus den eigenen Wohnvierteln ausnimmt. Denen geht bei der galoppierenden Verarmung langsam auch das Taschengeld aus und dann klauen die selbst oder sparen sich die Kosmetik. Aber die Touries haben noch dicke Geldbeutel. …. Am Ende wird dann doch alles irgendwie gut. Oder auch nicht …
Die Lesungsprogramme sind durchweg interaktiv gestaltet. Man/frau kann aber auch nur zuhören.
Im Mittelpunkt des „Erwachsenen“-Lesungsprogramms stehen neben meinen High-Matt-Erzählungen vom “Doppelkopp”, der tragischen Geschichte eines schizoFRenen FR-Lokal-Redakteurs, “Tally im Nahverkehr”, vom “schwarzen Halbtag im Leben des Redakteurs Rolf Kotau”, … Passagen aus Valentin Sengers „Buxweilers“, Carlo Levis „Christus kam nur bis Eboli“ und aus den Erzählungen Peter Kurzecks .. immer dort, wo sie die High-Matt kreuzen …. Dazu habe ich bei Carlo Levi eine eigene Erzählung verfasst unter dem Titel „Wie Carlo Levi nach Gründau kam“, die Geschichte von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und frühen „Gastarbeitern“ aus dem Mezzo Giorno aus Lukanien/Basilikata, aus Matera, Alta Muro, die in Gründau „hängengeblieben“ sind, wie die Badoglio-Italiener …
Darüber hinaus stehen zur Auswahl Lesungen aus meinen Romanen und Roman-Projekten: der Odenwald-Roman „Der Damenschneider“, der 68er-Frankfurt-Roman „Putztruppen“, der 1848er Roman „Der Erbsenzähler“ von der Männer-Freund-und Feindschaft zwischen dem schlesischen Bauernbefreier Dr. Hans Kudlich und Gregor Mendel, seinem Schulfreund aus ärmlichen Verhältnissen, der sich schon als Schüler als “Mendeljud” gehänselt immer gegen den Verdacht zur Wehr setzt, er sein Jude, und in seiner existentiellen Angst in die Arme der “Mutter” Kirche flieht, wo er als Franziskaner-Abt seinen Naturforschungen nachgehen kann …
Weiter Passagen aus dem Roman-Projekt „Onkelmord“, über die Geschichte eines hohen Wehrmachtsoffiziers
Alle Lesungsprogramme sind neben dem OpenEnd-Effekt bei den Kinder-& Jugendlichen-Geschichten –also der Anregung zur selbständigen Weitererzählung, Bebilderung usw… damit verbunden, dass ich zu Reportagen, Videoaufnahmen, Recherchen im der eigenen Stadt, im Dorf anrege.
Meine Wunschvorstellung ist dabei ein von LIT-Hessen, club Voltaire, naturfreunden/freidenkern/ arbeiterfotografie/nd/falken/junge GEW/-ver.di/dju/uz/jungeWelt/….. gemeinsam betriebenes und oder gesponsortes Portal mit dem Namen „WILLI“, das an die Arbeit Willi Münzenbergs anknüpfend den Jungen wie Alten die Möglichkeit bieten soll, ihre Texte, Bilder, Lieder, Musik und Theaterstücke, Filme, Reportagen, Objekte, Projekte und WorkShops einer kritisch-solidarischen Öffentlichkeit zu präsentieren, die diese Materialien für die eigene Arbeit nutzen, kritisieren, verbessern, umändern sollen, können..
Ein Portal, in dem regelmäßig auch zu bestimmten Themen Wettbewerbe ausgeschrieben werden mit Preisen zur Förderung dieser Arbeit der Basis.
Ein Portal, über das Initiativen auch die hier veröffentlichenden (Laien-) Künstler engagieren können.
Ich möchte dieses Wunschprojekt allen hier angesprochenen Organisationen ans Herz legen, denn bei vielen Telefonaten bekam ich bei den meisten Organisationen die Antwort: „ Aber das ist doch eher etwas für junge Leute, hier sind in der Regel nur noch Leute über 70 zu finden…..“ Wir sollten nicht so lange abwarten, bis es sich nur noch um Arbeits-Greise statt um Arbeits-Kreise handelt.
Und wenn das alles zuuuuu politisch sein sollte, ich kann auch gaaaanz unpolitsch:
Das entsprechende Lesungsprogramm heißt:
„GeBlödelDichte“ mit Texten, die auch der Robert gern hat.
Ein weiteres Programm ist die High-Matt-Lieder- Entschlüsselung: Warum im Kindergarten Revolutionslieder gesungen werden und keiner verbietet‘s : vom Kuckuck auf dem Baum bis zum Hoppe, hoppe Reiter, simsalabim und Hokuspokus, und Siehste net die Wutz im Garde …
Es gibt viel zu erzählen und gaaaanz viel zwischen den zeilen
Avanti, pame, adelante, auf, gehmer
HaBE
****Der Titel entstand 1969/70 mit meinem Gedicht „Was fällt Ihnen zu Heimat ein?“ (erschienen in „unter-schlag-zeilen: befreite worte, gebrochene reime, zur lage“ FFM 2005) . Der Wetterauer Dialekt-Autor Kurt-Werner Sänger hat den Begriff mit der Aufnahme in seine oberhessisch-Hinterländer-Geschichten in den Adelsstand erhoben.-
Wer sich genauer über meine Lesungen informieren will, kann das im Laufe des folgenden Textes tun, an dessen Ende viele LINKS zu videos, Podcasts und Bildern stehen:
Welche Referenzen ich HaBE?
ein paar Höhepunkte im teilweise eher konventionellen Kulturbetrieb:
1.& 2. & 3. Europäisches Poesie-Festival Frankfurt , Buchmesse Havanna 2006, Buchmesse Frankfurt 2004, 2005, 2006, Buchmesse Leipzig 2005, Buchmesse des ÖGB “KriLIt” –Wien 2011, VL-Zentrum Halle 2003, Radio X FFM (zusammen mit Jörg Sternberg), Radio CORAX Halle(drei Mal Lifelesungen), im Oktoberland-Vorprogramm zu Heiner Müllers “Zement” im Schauspiel Frankfurt 1976, Frankfurter Palmengarten 1976, Schweinehalle Hanau 1999, Hessischer Rundfunk (zusammen mit Dr. Manfred Köhler), Frankfurter Literatur-Telefon, ML-Uni Halle Wittenberg 2012, Konferenz Gegenöffentlichkeit Berlin, Uni der Künste 2001, Kabarett Sinnflut Weimar 2009, attac-Theater-Akademie Halle, Linker Liedersommer Burg Waldeck 2013 & 2015, Kulturprogramm: “Wacht auf, Verdammte dieser Erde” 35 jahre arbeiterfotografie/Werder in der Havel 2014 Kulturprogramm bei der Verleihung des Aachener Friedenspreises 2011 an Jürgen Grässlin und das IMI-Institut Tübingen zusammen mit Klaus dem Geiger….
Solidaritätslesungen und -Schreibungen bei Streiks:
ABB (Asean-Brown-Boveri), FSD (Frankfurter Sozietäts Druckerei), Frankfurter Rundschau, SIEMENS- Dematic,
SIEMENS- Dematic,  DUNLOP, VAC(VacuumSchmelze Hanau), Gate Gourmet, …. ATLAS, MAN-Roland, Triton, … Maredo, … Porzellanwerk Lichte,
DUNLOP, VAC(VacuumSchmelze Hanau), Gate Gourmet, …. ATLAS, MAN-Roland, Triton, … Maredo, … Porzellanwerk Lichte,
Lesung für die Belegschaft der Hanauer Firma HELLY, die gegen den Golfkrieg 1991 für anderthalb Stunden die Arbeit niederlegte (zusammen mit Wolfgang Stryi)
Lesung für die Gesamtbelegschaft der Stadt Langenselbold während der Arbeitszeit im Langenselbolder Bauhof (zusammen mit Wolfgang Stryi), Lesung zudammen mit Wolfgang Stryi in Hochstadt, Oberdorffelden, Schlüchtern in der Synagoge, in der Frankfurter Exzess-Halle, im Club Voltaire, im Hanauer Kultur-& Sozialzentrum Metzgerstraße im besetzten Haus, im Cafe Matrax in der Hanauer Sternstraße, in der IG-Metall-Schule Bad Orb,
Stadtbeschallende Lesung auf der Nidderauer Burg Windecken (zusammen mit Wolfgang Stryi 1993) und so weiter über 150 Konzert-Lesungen bis zum Tode Wolfgang Stryis
Lesungen/Konzerte in Schulen, Büchereien, Jugendzentren usw.:
Waldschule Offenbach-Tempelsee (2X), Stadtbibliothek Offenbach, Albert-Einstein-Gymnasium-Maintal, Maria-Ward-Gymnasium Aschaffenburg, Fröbelschule Maintal, Tümpelgartenschule Hanau, Gebeschusschule Hanau, Büchereien in Eichen, Nidderau, Gründau, Stadtbibliothek Hanau, Club Voltaire, Exzess-Halle, Gallus-Theater, Café Kante FFM, Stadthalle Hochstadt, zusammen mit Wolfgang Stryi (Kl/Sax), Synagoge Schlüchtern, Café ART Gelnhausen, Bücherei Hirzenhain, „Dorfgemeinschafts“-Haus Oberdorfelden, „Alte Scheune“ naturfreunde Bad König, diverse 1.Mai und May-Day-Aktionen, attac-Aktionen… BLOCK-& OKKUPY-Demos, Ostermärsche, Kita Niederdorffelden, Stadtbibliothek Eppelheim, Nachbarschaftshaus Hanau- Lamboy-Tümpelgarten, Sandelmühle Hanau zusammen mit Rolf Becker, Schenkenkeller Michelstadt zusammen mit „Quichote“, DGB-Jugendheim Hanau zusammen mit „Quijote“, Leipzig: zum Geburtstag von Mikis Theodorakis zusammen mit „Quijote“ ….
Kabarett-Lesungs-Konzerte und Workshops
in Döbeln, Schmiedeberg, Görlitz, Zittau, Stubbendorf/Ulenkrug, Berlin, Anklam, Rostock, Wismar, Weimar, Hildburghausen, Meiningen, Halle, Quedlinburg, Leipzig, Wien, Forst, Frankfurt/Oder, Prenzlau, Dresden, Pasewalk, …
Auslandslesungen
in Havanna, Trinidad, Santa Clara, in Grund- & Sekundarschulen, in Costa Rica & Nicaragua (Granada, Ometepe), in Monemvasia, Kalamata, Sparti, Kalavrita (Griechenland), in Venedig, Mestre, Bari, Brindisi, Alta Mura, Matera ….
In Polen in Warschawa, Opole, Gdansk, Gdynia, Krakow, Wroclaw, ….
Sowie ungezählte (ab 2003 wöchentlich am Freiheitsplatz nach Wiener Vorbild) Open-Air- WiderstandsLesungen und -Schreibungen von 1991 bis 2009 hauptsächlich in Hanau, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, …
Ach ja, ich hatte noch meine Literaturpreise vergessen:
Die Belegschaft von ABB-Alzenau hat mir nach den Warnstreiks gegen die Schließung des Werkes geschrieben, es hätte Spaß gemacht, mit mir zusammen warnzustreiken…, das war einer meiner wertvollsten Literaturpreise.
Ansonsten kann man/frau hier einiges von mir hören und sehen. In der Hoffnung, dass Ihnen/euch dabei das Hören und Sehen nicht vergeht:
http://www.barth-engelbart.de/?p=9245
Linke Lyriker verkaufen sich nicht ? Vonwegen ! HaBE Lesungen im Angebot für 400 € und einige podcasts, Videos, zum Probe-Hören und -Sehen
http://www.barth-engelbart.de/?p=9130
Ihr könnt mich gern HaBEn … für 400€ am Abend oder auch ne Klingelbeutel-Lesung wie die im Café Kante am FFMer Merianplatz. Der Buchhändler meines Vertrauens am Hanauer Freiheitsplatz, der jetzt total von Platanen befreit ist, sagte zu mir: „Linke Lyriker verkaufen sich nicht!“ Da hat er einerseits voll recht, in echt! Aber auch nicht: denn ich habe nie behauptet, ich sei nicht käuflich … siehe oben. Und auch weiter unten. Die teuerste Leung habe ich mit Wolfgang Stryi vom Frankfurter ensemble modern Mal in Maintal gemacht – in Hochstadt: er Tausend und ich Tausend, damals noch echte DeMark. Heute verkaufe ich mich solo erheblich preisgünstiger. Aber von Geld reden wir dann später …
Meine Lesungen möchte ich außer meinen Partnern und Freunden Wolfgang Stryi , Vittorio Arrigoni, Werner Pirker, Julius Mende, Giuliano Mer-Khamis, Beate Hübner, Harald Reuss …… auch meinem Kritiker und Freund Peter Kurzeck widmen. Warum ? Das kann man meinem Nachruf entnehmen: http://www.barth-engelbart.de/?p=9130
Hier folgen jetzt verschiedene Hör- und Sehproben, Bilder , Videos, prodcasts
und andere Sachen, die ich zwar aussprechen aber nicht bedienen kann. Ursula Behrs AntiKriegsbilder sind auch dabei. Einige habe ich betextet, Wolfgang Stryi hätte sie vertont wie bei unserem Stück über das ADLER-KZ „Katzbach“
http://www.barth-engelbart.de/?p=1145
Dass ATLAS die Erde trägt, mag ja stimmen, aber die ATLAS-Belegschaften in Vechta, Delmenhorst und Ganderkesee tragen nicht nur den ATLAS, sie haben ihn erschaffen!!
http://www.barth-engelbart.de/?p=944
http://www.barth-engelbart.de/?p=1196
Kleine Kostproben aus Frankfurt und Wien (und anderen Programmen) gibts hier, drei youtube-videos von Lesungen bei der Buchmesse des ÖGB, den Wiener KriLit-Tagen 2011 u.a. das KinderBilderBuch für 6 bis 96jährige “ZORA”
http://www.youtube.com/watch?v=_ZQhzY-Cj0w – 86k
GeBlödelDichte http://www.youtube.com/watch?v=OsyB8rVKF1k&feature=related
Auflösungsvertrag:
http://www.youtube.com/watch?v=3_rUDIPFgHA&feature=plcp&context=C3c4401dUDOEgsToPDskLaEUYTVp1GwX9eL6LoETua
10 Gedichte in 6 Minuten . HaBE am Frankfurter Literatur-Telefon
http://www.kunstraum-liebusch.de/data/media/LitTel_2007-06_Barth-Engelbart_unter_schlag_zeilen_.mp3
SEHEN und HÖREN geht auch hier: http://vimeo.com/43965928
Lamboy-Kids in Concert beim Kongress “schule kreativ 2000?
der Frankfurter Ernst-Reuter-Gesamtschule // Von den Kids und HaBE dem langjährigen response-Teamer, dem Komponisten, Saxophonisten & Klarinettisten des “ensemble modern”, Wolfgang Stryi gewidmet, der 2004 viel zu früh seine letzte große Welt-All-Konzert-Tournee angetreten hat. Wolfgang, wir hoffen wir sind laut genug, dass Du uns trotz FRAPORT und alledem da oben gut hören kannst.
http://www.kunstraum-liebusch.de/data/media/LitTel_2007-06_Barth-Engelbart_unter_schlag_zeilen_.mp3
http://www.podcast.de/episode/617544/Lyrik%2B%25C3%25BCber%2BAfghanistan%2B%2528Serie%2B191%253A%2BCorax-Widerhall%2529/
http://www.podcast.de/episode/667181/Hartmut%2BBarth-Engelbart%2B-%2BEin%2BLiebesgedicht%2B%2528Serie%2B191%253A%2BCorax-Widerhall%2529/
http://kz-adlerwerke.de/de/aktionen/auffuehrung/wiedergutmachung.html
http://kz-adlerwerke.de/de/aktionen/auffuehrung/schreibmaschine_schuetzenpanzer.html
http://kz-adlerwerke.de/de/aktionen/auffuehrung/lohnberechnung.html
http://kz-adlerwerke.de/de/aktionen/auffuehrung/erinnerungen.html
Unter “GRAFIKER” kann Frau & Man noch mehr sehn
HaBE etwas ZORA life und bombenfest
http://www.youtube.com/watch?v=OsyB8rVKF1k
http://www.youtube.com/watch?v=3_rUDIPFgHA
http://www.youtube.com/watch?v=_ZQhzY-Cj0w
http://www.youtube.com/watch?v=xt6f_eCja2A
http://vimeo.com/41729958
http://urs1798.wordpress.com/2010/12/12/licht-ins-dunkle-bringen-bilder-einer-ausstellung/
http://www.youtube.com/watch?v=fAbu4BCrXtI&feature=channel
http://urs1798.wordpress.com/2010/12/07/bilder-einer-ausstellung-kunstfreiheit-in-deutschland/jemen-2/
http://urs1798.wordpress.com/2010/12/12/licht-ins-dunkle-bringen-bilder-einer-ausstellung/
http://www.barth-engelbart.de/?p=1157
http://www.barth-engelbart.de/?p=1151
http://www.barth-engelbart.de/?p=1146
Abraham Melzer und Rolf Verleger nehmen Stellung im “Antisemitismus”-Streit um Bilder einer Ausstellung der Fulda-/Berliner Malerin Ursula Behr
http://www.barth-engelbart.de/?p=798
http://www.barth-engelbart.de/?p=793
http://www.barth-engelbart.de/?p=782
Mauer-Fall / Mauer-Fälle: http://urs1798.wordpress.com/2009/05/22/endspurt/#comment-793
http://urs1798.wordpress.com/2009/05/22/endspurt/#comment-793
Danke für die Geduld beim Scrollen und Durchzappen – auch durch manche Verdopplungen.
Ich hoffe, es hat Ihnen / euch etwas gebracht.
Herzlich HaBE